26.06.2025
Frühfranzösisch, aber späte Einsichten
Politikerinnen und Politiker erklären den Französischunterricht an der Primarschule zur Schicksalsfrage des Landes. Dabei zeigt die Realität: Früh angesetzt ist noch lange nicht gut gelernt – und schon gar nicht geliebt.
Der Zusammenhalt des Landes sei gefährdet, wenn das Frühfranzösisch abgeschafft werde. Das verkündete einst Christoph Eymann, Basler Bildungsdirektor im Bildungsfuror. Das behauptete auch alt Bundesrat Alain Berset, als der Kanton Thurgau den Französischunterricht an der Primarschule in Frage stellte. Und nun bläst Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ins gleiche Horn. Sie ist sogar bereit, den Kantonen dafür die Zuständigkeit der Bildungshoheit abzusprechen. Notfalls, so lässt sie verlauten, wolle sie das Frühfranzösisch gesetzlich verankern. Das Machtwort als pädagogische Antwort.
Ein Mythos namens «Landes-Zusammenhalt»
Es ist wohl gröberer Unsinn zu behaupten: Der «Landes-Zusammenhalt» – die vielbeschworene cohésion nationale – hänge vom Französischunterricht auf Primarstufe ab. Angesichts der ärmlichen Resultate nach Abschluss der Volksschule und des offenkundigen Unwillens vieler Schüler gegenüber der schwierigen Fremdsprache wirkt diese Behauptung bestenfalls abenteuerlich romantisch, schlimmstenfalls ideologisch verbohrt. Vielleicht wäre es klüger, die Primarschule spräche zuerst das Herz der Kinder an – und weckte die Liebe zur Romandie auf Schulreisen statt mit «Sprachbädern», die sich als Wortpfützen erweisen.
Von Versuchsklassen und politischen Manövern
Ich kam in der Babyboomer-Zeit zur Welt. Damals lernte man an keiner Primarschule Französisch – und trotzdem war der Landeszusammenhalt weder in Gefahr noch infrage gestellt. Im Gegenteil: Ich würde sagen, es war besser um ihn bestellt. Am heutigen Französischpensum der Primarstufe kann es also nicht liegen.
In den 1970er-Jahren wurde unsere vierte Klasse in Therwil zur «Versuchsklasse» für Frühfranzösisch erklärt. Ein Evaluationsbericht wurde nie publiziert. Die Bildungspolitik richtete sich schon damals nach der ideologischen Marschroute: Man führt etwas «provisorisch» ein – man führt etwas provisorisch und versuchsweise ein, um es unumkehrbar durchsetzen zu können. Kritik daran wird reflexhaft delegitimiert: Als eine Studienautorin Zweifel an der Effizienz des Frühfranzösischs anmeldete, attackierte Christoph Eymann gleich die Person, nur um sein Narrativ verteidigen zu können.
Crèmeschnitten statt Kommunikation
Ich erinnere mich noch an mein erstes Aha-Erlebnis vor dem Übertritt ans Progymnasium: Ich begriff, dass «est» und «sont» zusammengehören wie «ist» und «sind». Stolz erklärte ich es meinen Klassenkameraden, die ebenfalls zum ersten Mal das Prinzip des Konjugierens zu erfassen schienen. Das Wort «écureuil» war so tief in unser Gedächtnis eingebrannt wie heute vielleicht «mille-feuilles». Wir wussten also, was ein Eichhörnchen ist – kamen aber an der Oberstufe sprachlich auf die Welt. Heute können viele Sechstklässler eine Crèmeschnitte korrekt auf Französisch benennen, doch in einem Restaurant weder nach der Toilette fragen noch ein Coca-Cola bestellen. So jedenfalls die Erfahrung meiner Kinder nach drei Jahren Frühfranzösisch.
Zu viele Sprachen, zu wenig Bildung
Die jüngste Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) förderte Ernüchterndes zutage: Nur sieben Prozent der Realschülerinnen und Realschüler (Niveau A) erreichen die Mindestziele – im teuersten Bildungssystem der Welt.
Woran liegt’s? Die Primarschule ist mit zwei Fremdsprachen, ergänzt durch die dritte Fremdsprache Hochdeutsch, überfrachtet. Kinder mit Migrationshintergrund jonglieren oft mit vier Sprachen – und scheitern. Die Folge: Überforderung statt Verständigung, Sprachverwirrung statt Spracherwerb.
Die Verlagerung des Französischunterrichts in die Primarschule ist dabei keine pädagogische Feinjustierung, sondern der wichtigste und grösste strategische Grundfehler.
Auf dieser Stufe sind die Lernziele niedriger, der Unterricht unspezifischer, die Fortschritte langsamer, weil die Schüler noch nicht in ihre jeweiligen Leistungsniveaus aufgeteilt sind. Erst in der Oberstufe – wenn der Unterricht an das jeweilige Niveau angepasst ist – kann Spracherwerb wirklich fruchten. Vielleicht macht Französisch dann sogar Freude: Wenn es mit Erfahrungen verbunden wird, mit Reisen, Begegnungen, echten Freundschaften über Sprachgrenzen hinweg.
Daniel Wahl
Geschäftsleiter Lehrnetzwerk Schweiz, ehemaliger Primarlehrer, langjähriger Journalist
24.06.2025
Führungsstil der Schulleitung löst Flut von Kündigungen aus
14 teils langjährige und erfahrene Primarlehrpersonen haben ihr Arbeitsverhältnis an der Primarschule Allschwil auf Ende dieses Schuljahres gekündigt – dies teilte die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) auf Anfrage im Landrat mit. Hinzu kommen alle Lehrpersonen, die eine Verlängerung ihres auslaufenden Arbeitsvertrages ablehnten.
Die Vorwürfe vieler Lehrpersonen an die Adresse der Schulleitung wiegen schwer: willkürliches, schikanöses und gesetzwidriges Verhalten, Mobbing, Vetternwirtschaft mit der Bevorzugung von Familienangehörigen eines Schulleitungsmitgliedes, sowie ein autoritärer, teils diktatorischer Führungsstil.
Primarlehrpersonen erhalten Maulkorb
Der Starken Schule beider Basel (SSbB) sind in den vergangenen Tagen E-Mails, Briefe und verschiedene Dokumente von rund einem Dutzend Lehrerinnen und Lehrern zugestellt worden – mit brisantem Inhalt: Die Zustände an der Primarschule Allschwil seien laut mehreren Zuschriften sehr belastend. 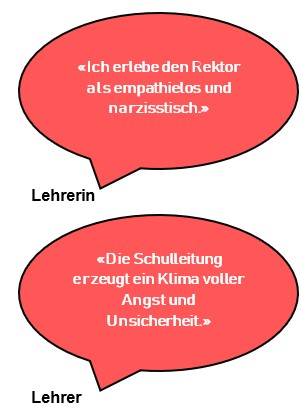
Seit einiger Zeit, so berichten Betroffene, sei eine freie Meinungsäusserung im Konvent kaum mehr möglich. Lehrpersonen, die es dennoch wagten, wurden vom Rektor zitiert und zurechtgewiesen. Vieles deutet darauf hin, dass den Primarlehrpersonen stillschweigend ein Maulkorb verpasst wurde – offenbar eine Überreaktion eines Schulleitungsmitglieds.
Der Rektor soll inzwischen seit Wochen krankgeschrieben sein. Nun ist er auf Tauchstation: Antworten auf Fragen der SSbB oder eine klärende Stellungnahme? Fehlanzeige. Wir hätten seine Darstellung gerne in diesem Artikel berücksichtigt.
Vetternwirtschaft – eine üble Sache
Es scheint kein Einzelfall zu sein: Schulleitungsmitglieder sollen bei Anstellungen und Stundenwünschen systematisch Familienangehörige, deren Freundinnen und Bekannte bevorzugen. Eine Lehrperson schreibt uns: «Die Tochter der Schulleiterin, obwohl diese erst seit Kurzem an unserer Schule, erhielt eine Unterstufenklasse» und darf ins gleiche Schulhaus wechseln, jenes Schulhaus, das von ihrer Mutter geleitet wird.
Eine andere Lehrperson bringt es pointiert auf den Punkt: «Eine derartige Bevorzugung von Familie und Freunden ist aus meiner Sicht in einem fairen und transparenten Schulsystem nicht vertretbar.»
Demgegenüber würden Wünsche von langjährigen und erfahrenen Lehrpersonen, die sich auch mal kritisch äussern, von der Schulleitung ignoriert oder sie würden sogar als Strafmassnahme aus ihren gut funktionierenden Teams herausgerissen, in ein anderes Schulhaus zwangsversetzt und das Ganze als Führungsmassnahme deklariert.
Ein Klima der Angst und Verunsicherung
Eine Primarlehrperson beschreibt uns die Situation wie folgt: «An der Primarschule Allschwil herrscht, aufgrund der Handlungen der Schulleitung, ein Klima voller Angst und Verunsicherung. Dieser belastende Zustand besteht nun seit fast zwei Jahren und verschärft sich zusehends». Zugespitzt habe sich die Situation, «nachdem sich das Kollegium für eine Kollegin starkgemacht hat, die ein Jahr lang vom Rektor (…) einen unbefristeten Vertrag versprochen bekam, diesen aber nicht erhalten hat». Solche «wiederholten Versprechen seitens der Schulleitung, die nicht eingehalten wurden», würden dem «Schulklima schaden».
Eine andere Lehrperson beschreibt den Führungsstil des Schulleiters als autoritär, bisweilen diktatorisch und prangert eine erhebliche Vetternwirtschaft an. Sie erlebe den Rektor als «empathielos».
Wird kantonales Recht missachtet? Streit um Entlastungslektionen.
Seit dem Schuljahr 2023/24 erhalten Klassenlehrpersonen der Primarstufe eine Jahreslektion zur Entlastung für administrative Aufgaben im Rahmen ihrer Klassenführung. Der Umgang mit dieser Entlastungslektion ist im kantonalen «Merkblatt Entlastungslektion Klassenlehrpersonen Primarstufe» durch das Amt für Volksschulen (AVS) geregelt. Insbesondere bei Teilpensen und geteilten Klassenlehrfunktionen im Jobsharing hält das Merkblatt unmissverständlich fest: «Eine Auszahlung der Entlastungslektion ist nicht möglich». (siehe folgende Darstellung aus dem Merkblatt)
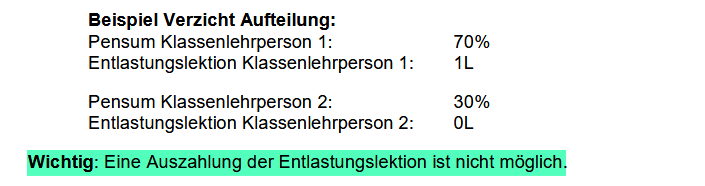
Nicht so in Allschwil: Lehrpersonen mussten sich laut mehreren E-Mails diese Entlastungsstunden auszahlen lassen – entgegen den unmissverständlichen Vorgaben des kantonalen Merkblatts. Eine Gutschrift in der Stundenbuchhaltung wurde ihnen verweigert. Warum die Schulleitung diese klare Weisung des AVS ignoriert, bleibt offen. Eine entsprechende Anfrage der SSbB bei der Schulleitung blieb unbeantwortet. Eine Schulleiterin verweigerte die Auskunft und verwiess lapidar auf die Schulratspräsidentin.
Kettenverträge sind meist unzulässig – die rechtliche Situation
Für Lehrpersonen mit abgeschlossener Ausbildung gilt gemäss §5 der Personalverordnung: «Der Arbeitsvertrag ist in der Regel unbefristet abzuschliessen». Ausnahmen regelt §6 der Personalverordnung. Ein befristeter Arbeitsvertrag ist nur dann zulässig, wenn eine der folgenden drei Bedingungen erfüllt ist:
a. für Anstellungen, die aufgrund ihrer Aufgabenstellung befristet sind;
b. für den befristeten Einsatz in einer Stellvertretungsfunktion;
c. für Anstellungen von Lehrpersonen, wenn die Ausbildung unvollständig ist.
Ist keine dieser Ausnahmen gegeben, besteht ein Anspruch auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Zwei typische Beispiele für rechtlich zulässige Befristungen gemäss §6 der Personalverordnung sind: Wenn eine Klasse vorübergehend eröffnet und dafür eine zusätzliche Lehrperson benötigt wird (lit. a.) oder wenn es sich um eine Vertretung z.B. bei einem Mutterschaftsurlaub handelt (lit. b.).
Wenn keine Ausnahmeregel vorliegt, bedeutet das faktisch: Lehrpersonen mit abgeschlossener Ausbildung werden in der Regel unbefristet angestellt. Während der ersten sechs Monate gilt die gesetzlich vorgesehene Probezeit, in der das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten unter erleichterten Bedingungen gekündigt werden kann.
Für Lehrpersonen, die ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben, sind in §6 die Abs. 2 und 5 relevant: Absatz 2 legt fest, dass die Gesamtdauer aller befristeten Arbeitsverhältnisse in der Regel 48 Monate nicht überschreiten soll. In Absatz 5 wird ergänzt, dass befristete Arbeitsverträge für dieselbe Funktion mit derselben Person in der Regel höchstens dreimal hintereinander abgeschlossen werden dürfen.
Für Lehrpersonen bedeutet das konkret: Da sie in der Regel keinen Funktionswechsel durchlaufen, ergibt sich faktisch eine maximale Befristungsdauer von 36 Monaten (drei aufeinanderfolgende Einjahresverträge in derselben Funktion).
Bei einem Funktionswechsel, was bei Lehrpersonen im Normalfall nicht vorkommt, wäre die 48-Monatsregel gemäss §6, Abs. 2 der Personalverordnung wirksam. Eine fortgesetzte Befristung ohne gesetzliche Grundlage ist daher rechtswidrig.
Missachtung von Personalgesetz und Personalverordnung
Zahlreiche Mails und Briefe belegen, dass sich der Rektor der Primarschule Allschwil wiederholt über die Vorgaben des Personalgesetzes und Personalverordnung hinwegsetzt. Gleichzeitig scheint die Schulratspräsidentin nicht in der Lage, die Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen durch die Schulleitung wirksam durchzusetzen. Nachfolgend ein exemplarischer Fall:
«Nachdem ich nun meinen fünften Arbeitsvertrag mit der Primarschule Allschwil erhalten soll und mir Herr (…) [genannt wird der Name des Rektors] mehrmals einen unbefristeten Vertrag zugesichert hat, war ich sehr irritiert und enttäuscht (…) zu erfahren, dass der Arbeitsvertrag wieder nur ein befristeter sein soll.» Nach einem klärenden Gespräch mit der Schulleitung, wurde der Lehrperson eröffnet, «dass sie möglicherweise gar keinen Vertrag mehr erhalten" wird. Und dies, obwohl der Stundenplan bereits an die Eltern verschickt und das «zugesagte Pensum in SAL eingetragen» wurde und der Rektor der Lehrperson «ein Budget von Fr. 1´800.- zugesprochen» hat «für ein Projekt mit der neuen Klasse im neuen Jahr».
Die Drohung der Schulleitung, dieser Lehrperson keinen neuen Vertrag zu erteilen, stellt ein klares Zeichen mangelnder Führungskultur dar und eine grobe Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben.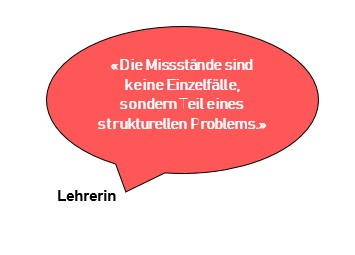
Der eingeschaltete Lehrerinnen- und Lehrerverband Baselland (LVB) reagiert mit einer «Anzeige arbeits- und führungsrechtlicher Missstände in der Schulleitung der Primarstufe Allschwil» und weist auf «schwerwiegende Führungsmängel im Schulbetrieb Allschwil» hin, die «nicht nur individualrechtlich, sondern auch aufsichtsrechtlich und systematisch Relevanz entfaltet». Das vom LVB treffend und brillant verfasste Schreiben deckt die «widersprüchliche Personalführung, strukturelle Benachteiligung und systematische Verunsicherung» auf. Und weiter: «Der Führungsstil der Schulleitung Allschwil zeichnet sich gemäss mehreren Rückmeldungen durch hohen Druck, mangelnden Respekt gegenüber Mitarbeitenden und fehlender Gesprächskultur auf. In den letzten zwei Jahren haben zahlreiche engagierte und langjährige Mitarbeitende die Schule verlassen – ein Umstand, der nicht etwa zur Reflexion führte, sondern zur Verschärfung der Kontrolle und Ausgrenzung seitens der Führungsverantwortlichen.»
Das oben dargestellte Beispiel ist nur eines von vielen, das die fortgesetzte Missachtung des Personalgesetzes und der Personalverordnung dokumentiert.
Die Schulleitung bedient sich sogenannter Kettenverträge (= jährlich befristeter Arbeitsverhältnisse), die über mehrere Jahre hinweg fortgesetzt werden, ohne dass ein unbefristeter Vertrag ausgestellt wird. Auch wenn eine rechtliche Qualifikation als „Kettenvertrag“ erst im Einzelfall durch ein Gericht erfolgen würde, deutet die systematische Praxis auf ein strategisches Machtmittel hin: Lehrpersonen, die als kritisch gelten, erhalten schlicht keinen neuen Vertrag.
Ausweichmanöver statt Aufsicht - eine überforderte Schulratspräsidentin
Die SSbB hat die Schulratspräsidentin mit konkreten Fragen zur Personalkrise an der Primarschule Allschwil konfrontiert. Ihre Antwort offenbart eine klare Verweigerungshaltung: Anstatt auf die nachweislich dokumentierten Vorwürfe oder die 14 Kündigungen einzugehen, versteckt sie sich hinter formalen Floskeln. Mit Verweis auf Datenschutz und Amtsgeheimnis weicht sie sämtlichen substanziellen Fragen aus – obwohl eine grundsätzliche Stellungnahme zur Arbeitssituation ohne Offenlegung personenbezogener Daten problemlos möglich wäre.
Besonders bezeichnend ist ihre Rückfrage nach dem "Zusammenhang" der Anfrage der SSbB, obwohl dieser angesichts der zahlreichen Kündigungen und eingegangenen Beschwerden offensichtlich ist.
Die pauschale Delegation der Verantwortung an den Kanton wirkt wie ein Ablenkungsmanöver einer Amtsträgerin, die entweder nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, zu den schwerwiegenden Vorwürfen von Mobbing und der Rechtsverletzungen Stellung zu beziehen.
Fazit
Die dokumentierten Führungsschwächen in der Schulleitung offenbaren gravierende systemische Defizite, verschärft durch eine überforderte und wenig durchsetzungsfähige Schulaufsicht. Wo Kontrollinstanzen versagen und destruktive Führungspraktiken toleriert oder gar gefördert werden, entsteht ein toxisches Arbeitsumfeld, das die Schulqualität gefährdet und Lehrpersonen, Schüler/-innen sowie Eltern nachhaltig belastet.
Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwerwiegende und teils irreversible Schäden durch personelle Fehlbesetzungen in Leitungsfunktionen entstehen können. Eine funktionierende Schule braucht integre, kompetente und kooperationsfähige Führungspersönlichkeiten, die das Wohl der Institution über Eigeninteresse stellen.
Angesichts der dokumentierten Missstände ist ein personeller Neuanfang unvermeidlich. Sowohl in der Schulleitung als auch im Schulrat müssen die verantwortlichen Personen zum Wohl der Schule ihre Ämter niederlegen und durch charakterlich geeignete, professionell ausgewiesene Personen ersetzt werden. Mit dem Ziel einer transparenten, respektvollen und konstruktiven Führungskultur. Nur so kann das beschädigte Vertrauen wiederhergestellt und eine positive Entwicklung der Primarschule Allschwil ermöglicht werden.
Jürg Wiedemann
Vorstand Starke Schule beider Basel
22.06.2025
Klare Mehrheit will weniger Fremd-
sprachen an den Primarschulen
Die Resultate der soeben durchgeführten Umfrage der Starken Schule beider Basel (SSbB) zum Thema Fremdsprachen an den Primarschulen sind eindeutig: Zwei Drittel der Umfrageteilnehmenden lehnt die Weiterführung von zwei Fremdsprachen an den Primarschulen ab. Wird auf nur noch eine Fremdsprache reduziert, so bevorzugen 53.1% Englisch, 34.5% Französisch. Eine deutliche Mehrheit ist zudem für einen späteren Fremdsprachenbeginn. Die meisten Umfrageteilnehmenden sprechen sich für einen Start in der 5. Primarklasse aus.
Umfrage stösst auf grosses Echo
Die SSbB lancierte die Umfrage als Reaktion auf den kürzlich erschienen Bericht «Überprüfung Grundkompetenzen» (ÜGK), dessen Resultate alarmierend sind: Knapp die Hälfte der Schüler*innen erreicht bis zum Ende der obligatorischen Schule in Französisch nicht einmal die elementaren Grundkompetenzen. So erstaunt das grosse Echo der Umfrage nicht.
891 Personen aus den beiden Basler Halbkantonen nahmen an der Umfrage teil (davon 80.3% Lehrpersonen der Volksschulen oder der Sekundarstufe 2). Von den 288 teilnehmenden Primarlehrpersonen unterrichten 45.8% mindestens eine der beiden Fremdsprachen (Französisch, Englisch).
Aufgrund der sehr grossen Anzahl der Teilnehmenden kann die Umfrage als aussagekräftig eingestuft werden.
Zwei Drittel befürworten eine Reduktion der Anzahl Fremdsprachen
Lediglich 30.5% der Umfrageteilnehmenden möchten an den Primarschulen beide Fremdsprachen Französisch und Englisch beibehalten. Eine deutliche Mehrheit von 66.3% spricht sich für eine Reduktion der Anzahl Fremdsprachen aus. Davon wünschen sich 16.1% sogar gar keine Fremdsprachen auf der Primarstufe. (siehe folgende Grafik)
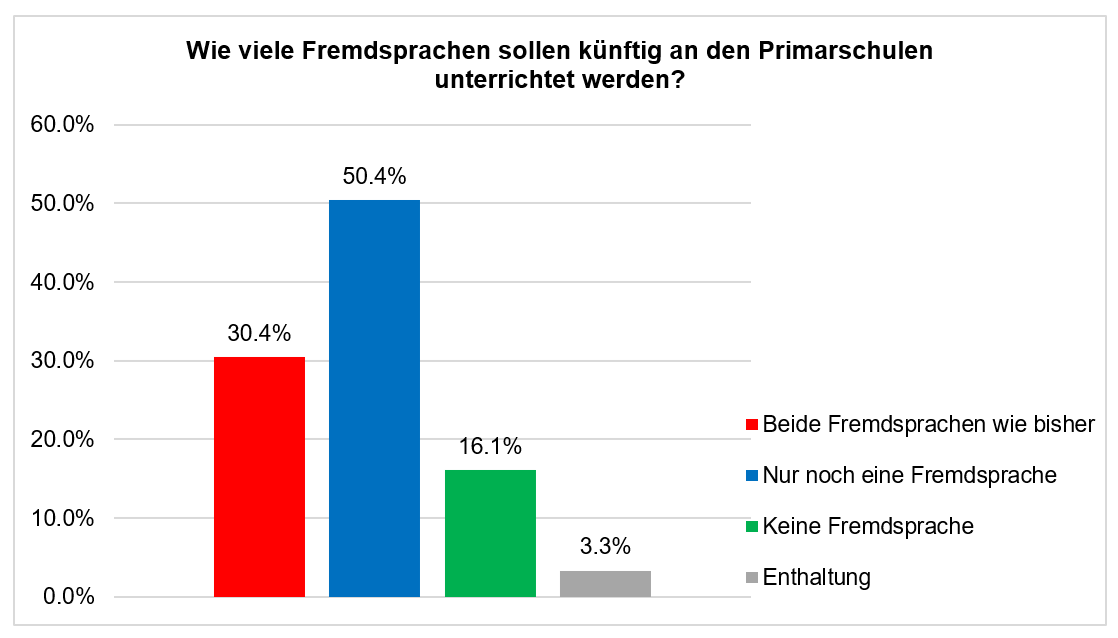
Eine klare Mehrheit der Fachwelt scheint sich einig zu sein: «Zwei Fremdsprachen an den Primarschulen sind mindestens eine zu viel», so der grosse Tenor der Rückmeldungen. Viele Schulkinder seien demotiviert und frustriert, wenn sie am Ende der Primarschulzeit im Fach Französisch kaum einen Satz sprechen und selbst einfachste Texte nicht verstehen können; dies trotz rund 400 Unterrichtslektionen von der 3. bis zur 6. Primarklasse.
Der Ressourcenverschleiss sei enorm und ginge zulasten anderer Fächer, betonten zahlreiche Lehrpersonen. In der Tat: Alle zu diesem Thema wissenschaftlich durchgeführten Studien (u.a. mehrere Pisa-Studien) zeigen nahezu das gleiche Resultat: Seit der Einführung von Frühfranzösisch ab der 3. Primarklasse und Englisch ab der 5. Primarklasse ist ein Leistungsabbau in Deutsch und Mathematik nachweisbar. Französisch sei «kontraproduktiv», formulierte es eine Lehrperson pointiert.
Eine Reduktion auf eine Fremdsprache nach dem Motto «weniger ist mehr» würde zu wesentlich «weniger Überforderung» führen und sei förderlich für das Lernklima, schreiben viele in ihren Antworten und begründeten ihre Position mit der einhergehenden Fokussierung auf nur noch eine Fremdsprache und der Folge, dass in dieser die Lernfortschritte grösser würden: «Mehr Tiefe statt Breite» sei anzustreben. Der grössere Erfolg würde die Schüler*innen «stärker motivieren». Ein Teil der gewonnenen zeitlichen Ressourcen sollten in die Fächer Deutsch und Mathematik investiert werden, um dort «vertieftes Wissen» aufzubauen und ein «gutes Fundament» für die nachfolgenden Schulstufen zu erzielen.
Als Hauptgrund für die Beibehaltung beider Fremdsprachen wurde angeführt, dass Französisch eine Landessprache und für den «Zusammenhalt der Schweiz» wichtig sei. Mehrere Lehrpersonen äusserten sich dahingehend, dass eine Fremdsprache in jungen Jahren einfacher zu lernen sei, nach dem Motto «je früher, desto besser». Deshalb müsse bereits an den Primarschulen mit beiden Fremdsprachen begonnen werden.
Zahlreiche Lehrpersonen betonten, dass die Motivation der Schüler*innen massgeblich mit spielerischen Lerninhalten einhergeht. Durch die spätere Einführung einer Fremdsprache würde dieser Aspekt komplett verloren gehen.
Englisch als klarer Favorit
Wird an den Primarschulen nur noch eine Fremdsprache unterrichtet, wünschen sich 53.1% Englisch, 34.5% Französisch bei 12.4% Enthaltungen. (siehe folgende Grafik)
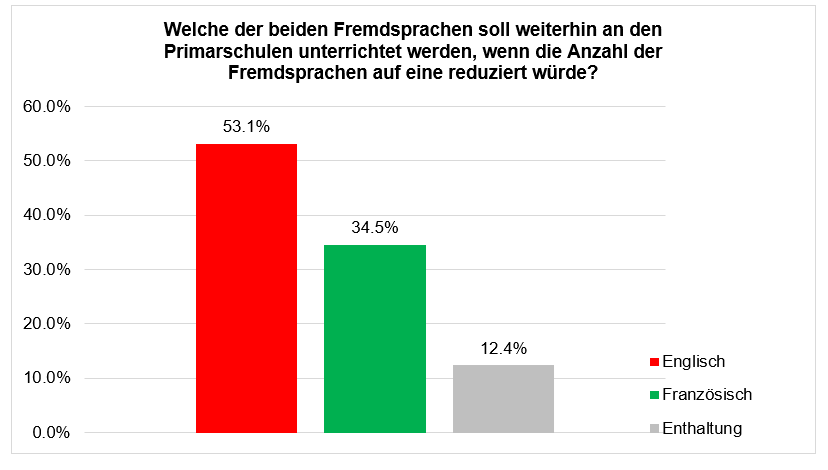
Mehrere Umfrageteilnehmende betonen, dass Englisch «greifbarer und besser verständlich» wäre und Lernerfolge sich schneller einstellen. Die Sprache sei «einfacher zugänglich und allgegenwärtig», beispielsweise bei den Sozialen Medien. Viele Jugendliche hätten deshalb «geringere Hemmungen» Englisch zu sprechen. Englisch sei eine «ideale Einsteiger-Sprache, weil es im Alltag vielerorts gesprochen und gehört wird».
Mehrheit spricht sich für späteren Fremdsprachenbeginn aus
Die Antworten auf die Frage «Wann soll die erste Fremdsprache beginnen?» zeigen ebenfalls ein klares Bild: Lediglich 30.1% möchten den Fremdsprachenbeginn in der 3. Klassen, 64.4% erst später. Favorisiert wird mit 37.6% die 5. Klasse als Startpunkt. (siehe folgende Grafik)
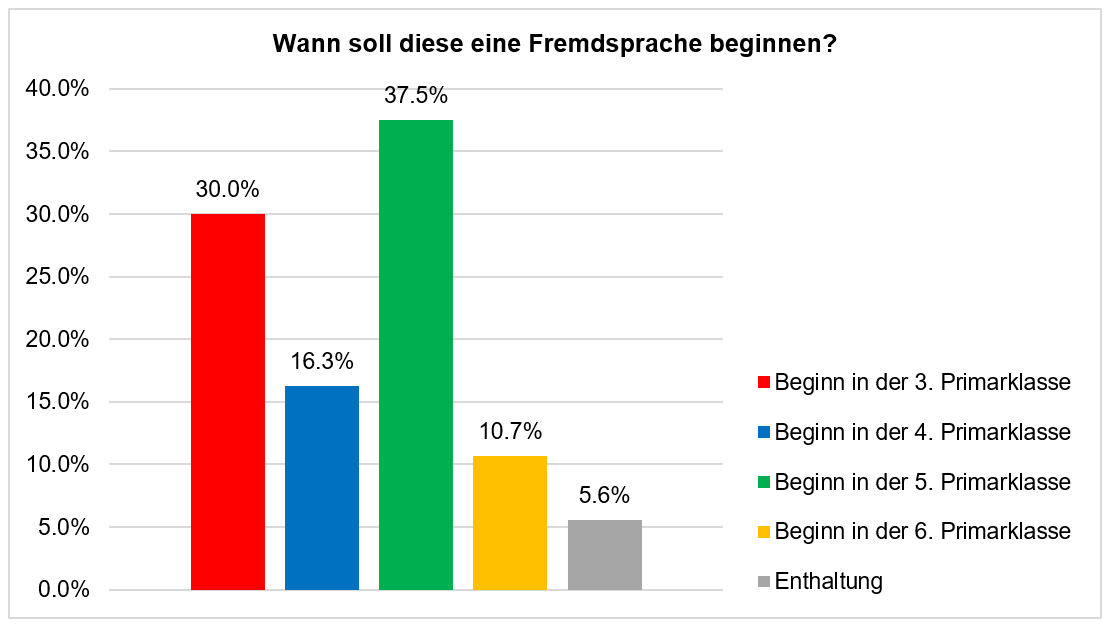
Von den Befragten wurde oft genannt, dass durch einen Fremdsprachenstart erst ab der 5. Klasse die Grundkompetenzen im Fach Deutsch gestärkt würden, was dazu führe, dass die Fremdsprache auf dieser Grundlage besser erlernt werden könne. Auch wird argumentiert, dass die Schüler*innen in der 3. Klasse «noch nicht die kognitiven Fähigkeiten besitzen», sich mit den grammatikalischen Grundlagen einer Fremdsprache auseinanderzusetzen.
Vor- und Nachteile von nur noch einer Fremdsprache
In freien Textfeldern konnten die Umfrageteilnehmenden Vor- und Nachteile beschreiben, wenn auf eine der beiden Fremdsprachen verzichtet würde. Davon wurde rege Gebrauch gemacht: 497 Vorteile und 256 Nachteile wurden formuliert. Folgend im Wortlaut eine kleine Auswahl mit Voten, die sehr häufig genannt wurden:
Vorteile von nur einer Fremdsprache
- Schwächere Primarschüler können sich auf den Erwerb der deutschen Sprache konzentrieren.
- Französisch in der Primarschule ist zu früh. Das führt zu Frustration und Misserfolg und "schlechtes" Französisch bringt kaum etwas und reduziert die Fachstunden in späteren Schuljahren massiv, wenn die SuS wirklich reif sind. Ist in diesem Sinne also kontraproduktiv.
- Weniger Überforderung und Verwirrung der SuS, welche ohnehin schon grosse Schwierigkeiten mit dem Deutsch haben
- Für viele Kinder ist Deutsch bereits die Zweitsprache. Französisch ist komplex und den Kindern fehlt meistens der Sinn und die Motivation für diese Sprache, da sie zu alltagsfremd ist.
- Weniger ist mehr
- Die Gesamtstundenzahl für Fremdsprachen wird nicht zu früh angebraucht und damit nicht verschwendet.
- Mehr Fokus auf eine Sprache und Chance eine zweite Sprache fundiert zu lernen. Darauf kann später aufgebaut werden.
- Lieber eine Fremdsprache richtig anstatt zwei Fremdsprachen und keine richtig!
- Weniger Druck und mehr Tiefe
- Sprachentwicklung der Deutschen Sprache bekommt allenfalls mehr Raum
- Der Fächerkanon wird um ein Fach reduziert.
- freiwerdende Ressourcen für Stabilisierung Deutsch, MT + musisches Feld einsetzbar.
- Weniger Stress für Kinder, mehr Freude an Fremdsprachen
- Erleichtert Zuzüge aus anderen Ländern wohl massiv (aktuell müssten teilweise bis 3 Sprachen neu gelernt werden)
- Konzentration auf eine Sprache, daher bessere Vertiefung durch mehr Lektionen
- Zeit für andere Lerninhalte
- Englisch als Weltsprache früh einführen, spielerisch aufbauend lernen können, rasch einsetzbar. Keine Überforderung durch das "zu schwierige" Französisch
- Die Anstrengungen eine neue Sprache in einem "klinischen" Umfeld (z.B. 3 Lektionen pro Woche) zu erlernen, bedingt mehr als künstliche Immersion und "Freude". Was bis jetzt leider fehlt, ist das Vermitteln der Strukturen (Grammatik!) der Fremdsprachen auf der Primarstufe. Die SuS fühlen sich unsicher, desorientiert und haben wenig bis oft keinen Mut die neue Fremdsprache "zu verwenden".
- Es bleibt mehr Zeit zur Förderung der Basiskompetenzen in den Bereichen Mathematik und Deutsch.
- Kinder lernen mit einer einfacheren Sprache [gemeint Englisch] auf diesem Niveau das Prinzip vom Fremdsprachenunterricht kennen und können dieses Wissen später für Französisch nutzen.
- Lieber weniger Fächer, dafür diese richtig als "von allem ein bisschen".
- Es bleibt mehr Zeit, um die Deutschkenntnisse zu verbessern, was dringend nötig ist.
- Weniger Stoffdruck/Notendruck.
- Fokus, keine Überforderung, Entlastung der kognitiven Ansprüche im Primarschulalter
- Eine Fremdsprache (aber intensiver) hat mehr Lerneffekt als zwei „so ein bisschen“.
- Die Kinder können zuerst ihre Kompetenzen in der Bildungssprache Deutsch festigen. Das stärkt das Verständnis in allen Fächern und schafft eine solide Basis für späteres Fremdsprachenlernen.
- Wird Französisch später eingeführt, kann es mit mehr Intensität und besseren methodischen Grundlagen unterrichtet werden.
- Die Kinder sind überfordert. Sie kommen in die Sek 1 und dann ins Gymnasium und hassen Französisch.
- Die Fremdsprachen belasten den Unterricht in mehreren Bereichen. Zeit, Stundenplanlegung, Raumangebot, Lehrpersonenbedarf… Ausserdem sind die SuS noch sehr mit den Grundlagen in Deutsch beschäftigt und in den letzten Jahren sehe ich hier einen deutlichen Qualitätsverlust.
- Es braucht weniger Lehrer; die Position des Klassenlehrers als direkte Beziehungsperson wird wieder gestärkt.
- Mehr Tiefe, weniger Breite.
- Für mich zeigt sich immer klarer, dass selbst Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, zunehmend einen zu kleinen Wortschatz und zu schlechte Kenntnisse ihrer Muttersprache haben, wodurch es ihnen immer schwerer fällt, Fremdsprachen zu lernen. Dieser Zusammenhang ist ja schon lange bekannt - aber dass es auch Kinder betrifft, die mit Deutsch als Muttersprache in der Schweiz aufwachsen, ist doch ein eher neues Phänomen.
- Nach 4 Jahren Französisch können sie gar nichts! Sek-Lehrer fangen wieder bei 0 an! Reine Zeitverschwendung.
- Mehr Zeit für bessere Deutschkenntnisse, einfachere Stundentafel, SuS und Eltern werden weniger belastet, weniger LPs für SuS, finanzielle Ressourcen werden entlastet
Nachteile von nur einer Fremdsprache
- Beide Sprachen ergänzen sich gut, da sie auch viele Parallelwörter enthalten. Die Kinder bringen bereits eine Sprache mit in die Schule. Alle Sprachen können somit gleichwertig unterrichtet werden. Keine Sprache verliert an Respekt.
- Kinder sind sehr wissbegierig in diesem Alter. Sie können locker mit zwei neuen Fremdsprachen umgehen und sehen dann auch, wie unterschiedlich diese sind (Horizonterweiterung).
- Das Französisch wird verloren gehen. Was sehr schade ist, da es eine Landessprache ist.
- Benachteiligung für Lehrpersonen mit zusätzlicher Ausbildung in der wegfallenden Sprache.
- Mehrsprachigkeit gehört zur Schweiz. Gute Englischkenntnisse ebenfalls. Der Röstigraben wird noch tiefer.
- Verlust der Fächervielfalt.
- Französisch ist nicht allgegenwertig, deshalb muss es als zweite Landessprache den SuS niederschwellig vorgestellt werden, insbesondere die Aussprache. Sprachstrukturen vergleichen ist einfacher, wenn man auf mehrere Sprachen referenzieren kann. Die französische Welt ist für uns ebenso wichtig, wie die anglo-amerikanische und gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Standpunkte einzunehmen.
- Sprachbegabte Kinder kommen zu kurz.
- Die Motivation, später dann noch Französisch zu lernen, wäre vermutlich noch weniger vorhanden.
- Verlust von nationaler Identität und Verlust der Möglichkeit einen ersten Kontakt mit einer weiteren Nationalsprache zu haben.
- Der spielerische Umgang mit der Fremdsprache geht mit einer späteren Einführung verloren.
- Wertschätzung für die Sprache muss übermittelt werden, ansonsten sinkt die Motivation schon früh.
- Französisch ist eine der Landessprachen der Schweiz. Es ist wichtig, dass deutschsprachige Kinder früh und, wie bisher, spielerisch einen guten Einstieg in die Sprache finden. Ich persönlich habe erlebt, dass Kinder ohne Migrationshintergrund durch den frühen Französischunterricht eine erste Begegnung mit einer anderen Sprache in der Schule erleben. Das hilft ihnen Brücken zu bauen und so zu lernen, wie man eine Fremdsprache lernt. Diese Verknüpfungen zur eigenen Sprache bilden die Basis für das Erlernen anderer Sprachen wie Italienisch, Spanisch etc.
- Wenn Französisch in der Primarschule gestrichen wird, kommen die Schüler:innen erst sehr spät mit dieser Landessprache in Kontakt. Der spielerische und unbefangene Umgang mit dieser schwierigen Sprache ginge verloren. Zudem ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich ein früher Spracherwerb positiv auf die Aussprache auswirkt. Ein akzentfreier Spracherwerb ist später kaum möglich.
- In der Schweiz werden mehrere Sprachen gesprochen, diese sollten alle unterrichtet werden.
- Für sprachbegabte Kinder ist es ein Verlust. Was soll mit den ausgebildeten Lehrpersonen passiere, wenn es ihr Fach plötzlich nicht mehr gibt?
- Multilingualer Unterricht fällt weg. Verknüpfungen der Sprachen nicht mehr so gut möglich und somit weniger Motivationskicks.
- Die kindliche Neugierde bricht so viele Hindernisse und es ist neurologisch bewiesen, dass man in jüngerem Alter besser Sprachen lernt.
Teilweise diametral unterschiedliche Voten der Primarlehrpersonen
Von den 288 teilnehmenden Primarlehrpersonen unterrichten 30.6% Französisch und 20.9% Englisch (Doppelzählung 5.6%, welche beide Fächer unterrichten). 54.2% unterrichten keine der beiden Fremdsprachen.
In einem zusätzlichen Prosatextfeld wurden die Fremdsprachenlehrpersonen dazu aufgefordert, ihre Beobachtungen und Erfahrungen bezüglich Motivation und Erreichen der Lernziele der Schüler*innen anzugeben. Lediglich 62 Lehrpersonen machten davon Gebrauch. Die Aussagen könnten teilweise kaum unterschiedlicher sein.
Obwohl primär nach den Erfahrungen im Bereich Motivation und Lernziele gefragt wurde, nutzten ausgesprochen viele Primarlehrpersonen diese Möglichkeit um über die Erfahrungen mit den Lehrmitteln zu berichten: Weitgehender Konsens dabei ist, dass das Französischlehrmittel «Mille feuilles», welches wesentlich die Passepartout-Ideologie mit ihren Fachtexten umsetzt, ein schlechtes Lehrmittel sei, mit welchem die Lernziele nicht erreicht werden konnten und welches für die Schüler*innen «frustrierend» sei. Die Lehrmittel «Ça roule» und «Ça bouge» hingegen werden wesentlich besser bewertet. Viele berichten, dass es seit dem Wechsel von «Mille feuilles» zu «Ça roule» und «Ça bouge» besser läuft.
Die Positionen bezüglich Motivation und Erreichen der Lernziele im Fach Französisch könnten unter den Primarlehrpersonen, die sich dazu in einem Prosatext äusserten, nicht gegensätzlicher sein: Während mehrere Lehrpersonen von «hochmotivierten» und «guten Schüler*innen» berichten, erwähnen andere stark «demotivierte» und «überforderte Kinder», welche oftmals die Lernziele nicht oder nur knapp erreichen. «Aufwand und Ertrag stehen in einem krassen Missverhältnis», so eine charakteristische Antwort. Dennoch scheint es eine gewisse Balance zwischen diesen positiven und negativen Erfahrungen im Französischunterricht zu geben.
Ein weitgehender Konsens (bis auf einige wenige Ausnahmen) zeigt sich betreffend Frühfranzösisch dahingehend: Sehr motivierte und gar begeisterte Schüler*innen in der 3. Klasse, zunehmende Demotivation und Frust je länger die Sprache unterrichtet wird. Eine Lehrperson bringt es folgendermassen auf den Punkt: «3. Klasse super, danach stetig abwärts, in der 6. Klasse kaum zu ertragen.»
Auch wird von vielen Französischlehrpersonen beobachtet, dass die Kinder häufig schon durch negative Erwartungen geprägt sind, da ihr Umfeld von schlechten Erfahrungen mit der Sprache spricht. So sei Französisch «schwierig», «kompliziert» und «unnütz». Dies mache es zusätzlich schwieriger, die Kinder zu motivieren.
Im Fach Englisch hingegen seien die Schüler*innen stehts motiviert, berichten die meisten Primarlehrpersonen in den Antworten. Die Kinder würden sich freuen und zeigen auch gute Lernerfolge.
Ein zentraler Knackpunkt in der Primarschullaufbahn sei für das Fach Französisch in der 5. Klasse mit der Einführung des Fachs Englisch. Die Kinder hätten in Englisch aufgrund der schon «mitgebrachten Erfahrung» und der «simpleren Struktur» dieser Sprache schnellere Erfolge als in Französisch, was sich gleichermassen motivierend auf den Englischunterricht wie demotivierend auf den Französischunterricht auswirke. Der Vergleich zwischen den beiden Fremdsprachen führe dann zu einer «Ablehnung» von Französisch. Viele Kinder würden ab dann Französisch «hassen»
Folgend einige im Wortlaut formulierte Aussagen:
- Zu Beginn sehr motiviert, dann nimmt es schnell ab.
- Die Motivation ist nur bei wenigen Kindern da. Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache ist die Motivation sehr gering.
- Ähnliche Erfahrungen wie in anderen Fächern, nichts, was im Vergleich zu Mathe, Deutsch etc. auffällig oder nennenswert ist, ausser, dass die Eltern den Kindern oft mitgeben, dass diese Sprache schwierig sei und sie in der Schule damit auch schon Mühe hatten.
- Mit dem Mille feuilles Konzept hat man einer ganzen Generation die Freude an der Sprache nachhaltig verdorben.
- Ich habe bis vor 4 Jahren mit Mille feuilles gearbeitet. Nun mit Ça roule und es läuft super. Die Kinder können viel mehr.
- Wenn der Unterricht gut gestaltet ist und abwechslungsreiche Lernsituationen bietet, sind die Kinder genauso motiviert wie in jedem anderen Fach.
- Geteilte Erfahrungen. Teilweise sind die Kinder sehr motiviert, andere wiederum können gar nichts damit anfangen / sind überfordert.
- Die Mehrheit der SuS ist nicht sonderlich am Französisch Lernen interessiert. Die Heterogenität der Klassen ist sehr gross, was bedeutet, dass einige die Lerninhalte nur sehr langsam lernen. Die Ziele werden nicht erreicht. Aufwand und Ertrag stehen in einem krassen Missverhältnis.
- Wenn der Unterricht spielerisch, strukturiert und rhythmisiert gestaltet ist, lieben die SchülerInnen das Fach Französisch. So erreichen sie auch die Lernziele. Primarschüler eigenen sich mit Leichtigkeit eine gute Aussprache an, was später nur noch mit Mühe geschafft wird.
- Für einige ist Franzi eine Vollkatastrophe, die Ablehnung fängt schon im Elternhaus an. Andere machen es sehr gut und sind engagierte Lernende.
- Die SuS sind oft überfordert, weil ihnen die Basis in der deutschen Sprache fehlt. Hinzu kommt die Tendenz, dass es heutzutage den Kindern oft schwerfällt, monotone Fleissaufgaben wie das Voci-Lernen zu erledigen.
- Englisch funktioniert gut, Französisch funktioniert schlecht.
- Englisch hohe Motivation – grosser Lernerfolg. Französisch immer weniger Motivation, kaum Lernerfolg.
- In der 4. Klasse ist die Motivation in Französisch hoch, sie nimmt bis zur 6. Klasse stetig ab. In dieser Zeit beginnen die Kinder sich auch mehr und mehr von den Lehrpersonen abzugrenzen. In Englisch ist die Motivation hoch, es fällt ihnen leicht. Viele sind enorm geübt, da sie durch die Medien täglichen Zugang zu dieser Sprache haben. Der Lernzuwachs in Englisch ist jedoch bei vielen Kindern gering. Kinder, die einen hohen Lernzuwachs in Englisch haben, sind oftmals auch im Französisch stark und motiviert.
- Schüler der 3. Klasse sind noch sehr motiviert. Je höher die Klasse, desto geringer die Motivation. (..) Sprachbad funktioniert leider nicht. Drei Lektionen sind kein Bad.
Starke Schule beider Basel dezidiert für nur eine Fremdsprache an den Primarschulen
Der Vorstand und das Sekretariatsteam der SSbB positionieren sich in einer internen Abstimmung einstimmig mit 9:0 Stimmen für die Reduktion auf nur eine Fremdsprache an den Primarschulen. Mit 8:1 Stimmen wird dabei Englisch favorisiert, welches weiterhin auf der Primarstufe unterrichtet werden soll. 7 Mitglieder befürworten einen Fremdsprachenstart in der 5. Primarklasse, je ein Mitglied in der 4. respektive 6. Klasse.
Der Start von Französisch soll erst in der ersten Sekundarklasse erfolgen, dafür mit einer höheren Stundendotation von 4 bis 5 Wochenlektionen. Mit 2 oder 3 Lektionen kann in einer derart schwierigen Sprache, wie es Französisch ist, kein angemessener Lernerfolg erzielt werden. Erfolgt der Unterricht in den Sekundarschulen niveaugetrennt und in einer höheren Konzentration, so sind die Erfolgsaussichten signifikant besser: Bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit werden mehr Schüler*innen die Lernziele erreichen.
Die Politik ist nun gefordert, das gescheiterte Projekt Frühfranzösisch mit seinen verheerenden negativen Folgen für die jüngsten Schulkinder zu beenden. Löst ein Fach derart viel Frust und Demotivation aus, dass viele Kinder es «hassen», so hat es seine Legitimation auf der Primarstufe verloren. Daran ändert auch nichts, dass es auch einige Primarlehrpersonen gibt, welche durchaus mit ihren Klassen in Französisch Erfolg haben.
Anahi Sidler, Sekretariat Starke Schule beider Basel
Lena Heitz, Vorstand Starke Schule beider Basel
22.06.2025
Geldhahn für Universität bald geschlossen?
Seit dem Jahr 2007 sind beide Basler Halbkantone gemeinsam Träger der Universität Basel. Gesteuert wird die Uni auf Basis des zwischen den beiden Halbkantonen ausgehandelten Universitätsvertrags und einem Globalbeitrag. In der Leistungsauftragsperiode 2022-2025 beträgt der Globalbeitrag 1.35 Milliarden Franken, wobei sich Baselland mit rund 661.3 Millionen Franken beteiligt.
Die beiden Regierungen haben kürzlich die Verhandlungen für die neue Leistungsperiode 2026-2029 abgeschlossen. Mit rund 1.504 Milliarden Franken soll die Uni im Vergleich zur vorherigen Periode 11% mehr finanzielle Beiträge erhalten.
Kompliziertes Finanzierungsmodell
Diese 1.504 Milliarden Franken werden zu 51.25% (771 Mio.) vom Stadtkanton und zu 48.75% (733 Mio.) vom Landkanton übernommen. Diese Prozentsätze kommen unter anderem durch das Finanzierungsmodell zustande, welches besagt, dass die Trägerkantone zunächst die Vollkosten für ihre Studierenden übernehmen. Da Baselland momentan 21.1% der Studierenden, Basel-Stadt jedoch nur 15.7% der Studierenden stellt, muss der Landkanton mehr zahlen. Baselstadt wird jedoch durch den Standortvorteil mit weiteren 84.7 Mio. Franken belastet. Das gesamte restliche Defizit der Uni wird auf die Trägerkantone verteilt, wobei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kantone berücksichtigt wird. Demnach muss der Stadtkanton 37.4 Mio. mehr als der Landkanton tragen.
Dass die beiden Trägerkantone die Restdefizite in der Höhe von über 350 Mio. Franken übernehmen müssen führt immer wieder zu Diskussionen. Gerade weil die einheimischen Studierendenzahlen überraschend gering sind. Die Basler Halbkantone zahlen so pro Studierenden 70'000 Franken, während sich die übrigen Kantone nur mit jeweils 15'000 Franken beteiligen müssen. Ob der Kanton Basel-Landschaft in seiner finanziell bereits hochangespannten Lage nicht besser fahren würde, wenn er seine Trägerschaft aufgäbe, ist jedoch fraglich.
Mehrere Gemeinden fordern Ausstieg aus dem Universitätsvertrag
Die fünf Baselbieter Gemeinden Rünenberg, Rümlingen, Oltigen, Zunzgen und Diepflingen fordern mithilfe einer Gemeindeinitiative die Kündigung der Uni-Trägerschaft mit Basel-Stadt bis Ende 2027. Im Kanton Basel-Landschaft müssen gemäss der Kantonsverfassung mindestens fünf Gemeinden hinter einer Gemeindeinitiative stehen, damit diese zustande kommt. Das Ziel dieser Initiative ist einerseits den Kanton finanziell zu entlasten, andererseits eine gerechtere nationale Verteilung der Universitätskosten zu erreichen. Der angestrebte, neue interkantonale Univertrag soll einen finanziell gerechteren Ausgleich erzielen.
Insgesamt bleibt die Situation angespannt und umstritten. Während die Universität ein wichtiges regionales Aushängeschild ist, wegweisende Forschung betreibt und somit unabdingbare Beiträge zu wissenschaftlichem Erfolg und Fortschritt leistet, sind die hohen anfallenden Kosten eine ernstzunehmende Belastung für die beiden Trägerkantone. Mit einem Ausstieg aus der Uni-Trägerschaft besteht jedoch das Risiko eines finanziellen Untergangs der Universität Basel mit entsprechendem Bildungsabbau. Dementsprechend sinnvoller wäre das Pochen auf eine interkantonale Einigung, um einen voreiligen Austritt des Kantons Basel-Landschaft und den Ruin der Uni Basel zu verhindern.
Lena Bubendorf
Vorstand Starke Schule beider Basel
19.06.2025
Wirtschaftsmittelschule unter Druck
Die Wirtschaftsmittelschule (WMS) ist eine weiterführende Schule, an der gleichzeitig eine breite Allgemeinbildung und eine kaufmännische Berufsausbildung erfolgt. Der Schulabschluss beinhaltet das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) Kauffrau/Kaufmann und die Berufsmaturität Typ Wirtschaft. Damit ist sowohl der direkte Einstieg ins Berufsleben als auch der Weg zur Fachhochschule offen.
Das Schulmodell der WMS klingt also durchaus vielversprechend. Die Jugendlichen werden weiter in Allgemeinwissen aber auch berufsspezifischem Wissen gefördert und haben zudem mit dem Langzeitpraktikum einen umfassenden Einblick in die Praxis.
Trotzdem steht die WMS unter Druck, denn gerade die Ergebnisse der Umfrage vergangenen Herbsts, die in den 1. Klassen der Standorte Liestal und Reinach durchgeführt wurde, stimmten nachdenklich. Nur jede zweite Person ist wirklich am kaufmännischen Beruf interessiert, doch genau für diesen bildet die Schule aus. Zudem gaben rund 45% der Befragten an, die WMS aufgrund der häufigen Ferien zu besuchen. Dies ist deshalb problematisch, weil bereits ein Fachkräftemangel herrscht und die Berufslehre weiter an Bedeutung verliert.
Marc Scherrer (Mitte) sieht die WMS als direkte Konkurrentin der dualen Berufsbildung und fordert, dass der Eintritt an die WMS erschwert wird. Dies gelänge, indem beispielsweise davor Bewerbungen für eine Berufslehre eingereicht werden müssen und eine Aufnahme nur dann erfolgt, wenn es keine passende Lehrstellen im gewünschten Beruf gibt. Ein anderer Ansatz wäre die Ferien zu kürzen.
Demgegenüber steht jedoch das Argument, dass viele Jugendliche sich für eine weiterführende Schule entscheiden, weil sie einerseits gerne in die Schule gehen und andererseits noch nicht wissen, welchen Beruf sie in Zukunft ausüben wollen. Bei einer Erschwerung des Aufnahmeprozesses ist es also wahrscheinlich, dass andere weiterführende Schulen oder Brückenangebote an Anmeldungen gewinnen. Die WMS als Sündenbock für den steigenden Fachkräftemangel und das sinkende Interesse an Berufslehren hinzuhalten, ist ungerecht. Stattdessen muss weiterhin auf die Attraktivität von Lehrberufen hingearbeitet werden und die Jugendlichen bei ihrer Wahl schon frühzeitig unterstützt werden.
Lena Bubendorf
Vorstand Starke Schule beider Basel
17.06.2025 - Gastbeitrag
Deutsch ist die Herausforderung nicht das Frühfranzösisch
Richtig Deutsch lernen in der Primarschule ist eine Herkulesaufgabe, die oft unterschätzt wird. Nötig ist eine durchdachte Lernstrategie, die in enger Verbindung zu den Realienfächern steht. Das überladene Sprachenkonzept mit Englisch und Französisch steht diesem Auftrag im Weg.
Der sprachfördernde und beliebte Realienunterricht hat durch die Frühspracheneuphorie viel an Bedeutung verloren. Seit Jahren liegt bei den Lehrkräften ein Schwerpunkt auf der Englischweiterbildung, während der Erzählkunst im Realienbereich wenig Beachtung geschenkt wird. Dabei wissen wir, dass spannende Geschichten und ein anschaulicher Sachunterricht zentrale Voraussetzungen für das Verstehen von Texten schaffen. Schüler können besser an neue Inhalte andocken, wenn sie über das nötige Vorwissen verfügen.
Sprache wächst um einen vorhandenen Wissenskern
Das verzettelte Fremdsprachenlernen hingegen führt nicht zum erhofften Effekt des leichten Andockens. Wer in keiner Sprache zuhause ist, dem fehlen die starken inneren Bilder, von denen aus ein vorhandener Wissenskern erfolgreich erweitert werden kann. Statt von einer Sprache in die andere zu switchen, ist eine Konzentration auf einen abwechslungsreichen Deutschunterricht viel effizienter. Mehr systematische Sprachgewöhnung, mehr eigenes Schreiben von Texten, mehr Zeit für Poesie und Jugendliteratur und nicht zuletzt mehr narrativer Geschichtsunterricht gehören zu einem wirklich kulturfördernden Grundprogramm.
Die zweite Fremdsprache gehört auf die Oberstufe
Statt sich auf zwei frühe Fremdsprachen zu verzetteln, gilt es, sich in der fünften und sechsten Klasse auf eine einzige zu beschränken. Englisch hat bei unserer Jugend zweifellos die weit besseren Karten, doch Französisch ist eine unserer Landessprachen. Welche Sprache später gelernt werden soll, ist kein Entscheid gegen diese Sprache, sondern ein notwendiger Schritt zur Entlastung der Primarschule.
Hanspeter Amstutz
Ehemaliger Bildungsrat und Sekundarschulehrer
16.06.2025 - Gastbeitrag
Gesunde Schule, kranke Lehrkräfte
Das Ende des Schuljahres nähert sich mit grossen Schritten. Hier eine kleine Bilanz: «Immer mehr Lehrpersonen melden sich krank» titelte diese Zeitung vergangene Woche mit Bezug auf Zahlen im Kanton Basel-Stadt. Oder, wiederum im Stadtkanton: Die Zahl jener Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe, die mit Französisch allergrösste Mühe bekunden, ist auf beängstigend hohem Niveau.
Steckt unser Bildungssystem also in einer Krise? Disclaimer: Als Kinderloser ist mein Abstand zum Schulwesen naturgemäss recht gross. Aus zahlreichen Gesprächen mit Lehrpersonen und Eltern ergibt sich aber ein durchaus differenziertes Bild. Meine eigene Schulund kurze Lehrerhistorie hat mich ausserdem in einem bestärkt: Der beste Schulweg ist der Mittelweg zwischen Reformen und Erstarrung.
In Basel-Stadt setzte in den Neunzigerjahren eine regelrechte Reformitis ein. Der Geist der Achtzigerbewegung durchdrang das Erziehungsdepartement und die Lehrerzimmer und führte zu Neuerungen, die längst wieder rückgängig gemacht wurden. Als Aussenstehender verlor man damals leicht den Überblick über die Strukturen, Reformen wurden – wie in der Privatwirtschaft bei grossen Konzernen die Restrukturierungen – zum Selbstzweck.
«Der beste Weg ist jener zwischen Reformen und Erstarrung.»
Handkehrum machte ich in den Neunzigerjahren als Deutschlehrer an einer Schule in England die Erfahrung, wie beklemmend sich Strukturen anfühlen, die aus früherenZeiten stammen und die nicht auf soziale Durchlässigkeit sondern auf Zementierung der Verhältnisse ausgerichtet sind. Wer einen Beweis möchte, dass auf der Insel alles beim Alten geblieben ist, schaue sich die Netflix-Serie «Adolescence » an, insbesondere jenen Teil, der an der Schule des jungen Protagonisten spielt. Dass die Serie nun an sämtlichen Sekundarschulen in England gezeigt werden soll, lässt doch Anfänge einer Selbsterkenntnis schliessen.
Szenenwechsel. Vergangene Woche feierte das basel-städtische Zentrum für Brückenangebote sein 25-Jahr-Jubiläum. Der Festakt im Volkshaus geriet zur freudigen Demonstration einer Schule, deren Zweck – die Vorbereitung aufs Berufsleben für jene, die dafür etwas länger benötigen – in einem urbanen und von Immigration geprägten Umfeld wie Basel ganz besonders sinnvoll erscheint.
Erziehungsdirektor Mustafa Atici (SP) hielt eine kurze Rede, in der er an die anwesenden Schülerinnen und Schüler appellierte, Mut und Durchhaltevermögen zu zeigen und ihren eigenen Weg zu gehen. Umso glaubwürdiger wirkte Atici, da er zur Veranschaulichung von Lebenswegen, die nicht unbedingt schnurstracks verlaufen, seine eigene Biografie in die Ansprache verweben konnte. Das war rhetorisch grosse Klasse und es verwunderte nicht, dass es im mit Schülerinnen und Schülern vollbesetzten Saal für einen kurzen Moment mucksmäuschenstill wurde.
Wechseln wir nochmals die Szenerie und begeben uns ins solothurnische Leimental. Vor vier Wochen feierte das dortige Oberstufenzentrum, wegen der giftgrünen Farbe an den Gebäuden früher liebevoll «Laubfrosch» genannt, seinen 50. Geburtstag. Auch diese Festivität schien mir von einem guten Geist beseelt. Aber ich erinnere mich noch wie heute an jene Tage meiner dortigen Progymnasialzeit, da sich die links-progressiven Lehrkräfte mit dem konservativen Rektor eine auch für uns Schülerinnen und Schüler spürbare, harte Auseinandersetzung lieferten.
In den vergangenen 40 Jahren hat sich der «Laubfrosch» analog zum Wachstum der Agglomeration erweitert: Neue, ziemlich generische Architektur stülpt sich mittlerweile über den Brutalismus der Siebzigerjahre, ohne ihn aber ganz verschwinden zu lassen.
Man sollte diesen stilistischen Mischmasch nicht symbolisch überhöhen, jedoch steht er durchaus für die Veränderungen dessen, was eine gute Schule braucht: ständige intellektuelle Erweiterung und gleichzeitig eine gewisse Resilienz gegenüber dem Zeitgeist. Das scheint mir hierzulande gegeben. Sehr beunruhigend bleibt die Zunahme der Krankheitsfälle bei Lehrpersonen. Die Politik sollte hier, wie einst beim Pflegepersonal, ein Handlungsfeld eröffnen.
Patrick Marcolli, Chefredaktor bz Basel
[Quelle: bz Basel vom 10. Juni 2025]
15.06.2025 - Gastbeitrag
Macht Schluss, Ihr Idioten!
Zugegeben, der Vergleich mag etwas martialisch, geschmacklos und weithergeholt tönen, aber im Kern stimmt er. Als man den Generalfeldmarschall Rundstedt im Juli 1944 nach der Landung der Alliierten fragte, was man tun solle, antwortete dieser: «Macht Schluss, Ihr Idioten!»
Die ÜGK-Teste hatte man uns damals als Teil eines Bildungsmonitorings angepriesen. Die Teste erheben den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Grundkompetenzen, was im Prinzip minimale Standards sind. Diese Teste sollten uns also Informationen über die Schwachstellen in unserem Bildungssystem liefern. Daraufhin, so die Versprechungen der EDK und der Bildungsverwaltung, würde man Massnahmen ergreifen, welche diese Mängel verbessern, wenn nicht beseitigen sollten. Das nennt man dann “evidenzbasierte Bildungspolitik”! Abgesehen davon, dass wir diesen Anspruch immer schon als technokratische Allmachtsfantasie belächelt haben, stellen wir fest, dass nichts von diesen Versprechungen eingehalten wurde. Es sind nun schon die zweiten grossangelegten Testbatterien, die diesen monumentalen Irrtum des Frühfranzösisch belegen. Knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der Deutschschweiz sind in der Lage die Grundkompetenzen zu erfüllen. Passiert ist nichts, und wie bei der letzten ÜGK-Runde 2019 hört man ausser betretener Ratlosigkeit nichts.
Den Vogel abgeschossen hat wieder einmal der LCH, der in einer Medienmitteilung kundtat: “Obwohl Lehrpersonen einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht durchführen wollen, zeigen die Ergebnisse, dass die Voraussetzungen dazu fehlen. Die gesetzten Ziele sind unrealistisch. Der LCH fordert die kantonale Bildungspolitik und die Behörden dringend auf, die Situation sorgfältig zu analysieren und darauf basierend die Ziele der EDK Sprachenstrategie unter Einbezug von Fachgremien und Praxisvertretungen zu überarbeiten und wirksame strukturelle Massnahmen umzusetzen”.
Übersetzt heisst dies wohl: Anforderungen senken, und mehr Geld in das System einschiessen!
Ich halte es lieber mit dem ollen Generalfeldmarschall: «Macht Schluss mit dem Frühfranzösisch, ihr Idioten!» Französischunterricht wieder in die 5. Klasse verschieben, gründlich Deutsch lernen. Das ist billiger und effektiver!
Alain Pichard, Lehrer Sekundarstufe 1
[Quelle: Condorcet Blog]
13.06.2025
Konstruktiver Austausch zwischen der FSS und der SSbB
In regelmässigen Abständen findet zwischen der freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt (FSS) und der Starken Schule beider Basel (SSbB) ein Austauschgespräch statt.
Beim vergangenen Gespräch anfangs Mai wurden diverse Themen behandelt: Handhabung von Handy- und Social Media-Verbot an Schulen, Schwierigkeiten mit der Integrativen Beschulung, Einführung der ersten Förderklassen. Weiter ging es um die Problematik der Schulräume im Stadtkanton betreffend Hitzeschutz in den Klassenräumen. Ein wichtiges Thema betraf das neue Maturitätsreglement resp. den Umsetzungsvorschlag der Baselbieter Regierung sowie entsprechende Regelungen im Stadtkanton. Ein brisantes Thema war das Personalgesetz betreffend fehlenden Anfechtungsmöglichkeiten von Verwarnungen. Auch hier wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Halbkantonen besprochen.
Das nächste Austauschgespräch findet im Oktober statt.
Anahi Sidler
Sekretariat Starke Schule beider Basel
12.06.2025
Der Rettungsversuch der Fremdsprachendidaktiker
Die Fremdsprachendidaktiker der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz reagieren mit einem Synthesepapier Sprachenunterricht: Zwei Fremdsprachen ab der Primarstufe vom 27.03.2025 [1] fast schon verzweifelt auf die Forderungen nach einer Änderung des Sprachenkonzepts. Es gleicht einem Appell an die Entscheidungsträger im Schulbereich, sich nicht vom eingeschlagenen Kurs abbringen zu lassen.
Seit 2004 gibt es die gesetzliche Grundlage, wonach ab dem 3. Schuljahr die erste, ab dem 5. Schuljahr die zweite Fremdsprache in der Primarschule unterrichtet werden muss. Eine der Sprachen muss eine Landessprache sein. Seit etwa 2010 wird das Konzept flächendeckend umgesetzt mit Lehrmitteln, die explizit dafür geschaffen wurden und eine ganz neue Lehrmethode enthalten, die sogenannte Mehrsprachigkeitsdidaktik.
Inzwischen sind jedoch starke Zweifel an der Effizienz des damaligen Konzeptes aufgetaucht, denn die Erfolgskontrollen, die in Französisch durchgeführt wurden, waren alles andere als berauschend:
1. Die mit summa cum laude bewertete Masterarbeit von Susanne Zbinden [2]
2017 legte Susanne Zbinden ihre Masterarbeit vor, in der sie 500 Realschüler(innen) mit 43 Aufgaben darauf testete, wie gut sie französische Texte verstehen. Je die Hälfte der Getesteten hatten mit den Lehrmitteln der Mehrsprachigkeitsdidaktik (Mille feuilles und Clin d’Oeil) und mit dem bisherigen Buch (Bonne Chance) gearbeitet. Das Resultat war eindeutig, obwohl der Test sich textlich auf die neuen Lehrmittel bezog: Die Schüler*innen mit dem älteren Lehrmittel waren hoch signifikant besser im Leseverständnis.
Zbinden ging den Ursachen nach und stellte gravierende Fehlüberlegungen bei der neuen Didaktik fest, wie sie aus der von ihr konsultierten internationalen Fachliteratur belegen kann:
- Das Fehlen von Wortschatz- und Grammatikkenntnissen erschwert das Textverständnis.
- Die stark betonte Förderung von Strategien zur Erschliessung des Verständnisses nützt wenig. Strategien greifen erst ab einer Kompetenzstufe C1, sind also im Schulbereich noch nicht erfolgversprechend.
- Die ausschliessliche Verwendung von authentischen Texten im Anfangsunterricht wird wegen der Dichte von neuem Sprachmaterial, das verwirrt und ablenkt, nicht empfohlen.
- Die Tatsache, dass in den neuen Lehrmitteln vieles nur angetroffen, aber nicht verbindlich gelernt wird, hinterlässt zu wenig Sprachwissen, das zum Verständnis von Texten notwendig ist.
2. Der Evaluationsbericht Wiedenkeller/Lenz von 2019 [3]
2019 veröffentlichten Eva Wiedenkeller und Peter Lenz die Ergebnisbezogene Evaluation des Französischunterrichts in der 6. Klasse in den sechs Passepartout-Kantonen.
«Für die Passepartout-Kantone galt … als Grundanforderung nach 4 Jahren Französisch das Niveau A2.1. …: Nur 33% schafften das Leseverstehen und 57% das Hörverstehen. Richtig niederschmetternd waren hingegen die nur vom IfM geprüften Sprechkompetenzen: Ganze 42,5 % schafften das Niveau A1.2 und gar nur 11 % das von Passepartout anvisierte Niveau A2.1.»
Ausserdem stellten sie fest, dass die Motivation für Französisch bei den Kindern sehr tief war. Die Autoren nannten ähnliche Verbesserungsvorschläge wie S. Zbinden.
3. Die Überprüfung der Grundkompetenzen in den Sprachen von 2023 [4]
Schweizweit verstehen nur 58% der Jugendlichen, was sie hören, und nur 51%, was sie lesen, wenn sie die obligatorische Schule verlassen. Das heisst, über 40% der Schulabgehenden verstehen nicht, was sie hören, und fast die Hälfte versteht nicht, was sie liest.
4. Pseudowissenschaft. Die Untersuchung von R. Berthele [5]
In seinem Aufsatz im Journal of the European Second Language Association geht Ralph Berthele, Professor für Mehrsprachigkeit an der Universität Fribourg, auf mehrere Studien von Schweizer PH-Dozenten ein, die auch im vorliegenden Thesenpapier wieder angeführt werden: z.B. Le Pape, Haenni Loti, Manno. Er entlarvt wissenschaftlich unzulässige Manipulationen, um Effekte nachzuweisen, welche die Studien gar nicht hergeben:
- Nachträgliches Abändern von Hypothesen
- Korrelationen als Kausalitäten ausgeben, obwohl andere mögliche Parameter nicht untersucht wurden
- Verschweigen von Zweitstudien, welche die Effekte der Erststudie nicht bestätigten
- spekulative Hypothesen als evidenzbasierte Erkenntnisse ausgeben
- unzulässige Übertragungen von Wirkungen bei erwachsenen Linguistikstudenten auf Volksschüler, etc.
5. Die Reaktion der Bevölkerung
Längst ist in der Öffentlichkeit ruchbar geworden, dass der Französischunterricht «für die Füchse» ist. Im Kanton Baselland erhielt das Stimmvolk im Herbst 2019 durch eine Initiative der Starken Schule beider Basel die Möglichkeit, über die Lehrmittel Mille feuilles und Clin d’Oeil abzustimmen. Fast 85% stimmten für die Lehrmittelfreiheit, was im Endeffekt die Abwahl des obligatorischen Französischbuches bedeutete. Auch über den grossen Missmut in der Bevölkerung verliert das Papier von Egli Cuenat et al. kein Wort.
6. Die Masterarbeit Henzi zu Clin d’Oeil [6]
Henzi misst die Vorgaben, welche sich die Autoren des Buches zum Ziel gesetzt haben, an der konkreten Umsetzung in Clin d’Oeil. Er zeigt auf:
- Die Autoren setzen auf den natürlichen, ungesteuerten Spracherwerb via motivierende Sachtexte, durchbrechen diese Absicht jedoch mit Sprachreflexionen, Lernstrategien, Wortschatzlisten. Das Ziel des natürlichen Spracherwerbs müsste mit immersivem Unterricht in Sachfächern angestrebt werden.
- Clin d’Oeil enthält unbestrittenermassen hervorragendes authentisches Material, allerdings ist es didaktisch zu wenig aufbereitet, so dass die Jugendlichen nicht wirklich zum Verstehen und Memorieren angehalten werden, sondern in einer Art Sight-Seeing (Anhören, Anschauen, Durchlesen) darüber hinweggehen, ohne dass Erinnerungsspuren gelegt werden.
- Dadurch, dass sich das Material an muttersprachigen Gleichaltrigen orientiert, ist es für Französischlernende sprachlich zu schwierig, insbesondere für Schwächere. Bei ihnen verpufft der grosse editorische Aufwand wirkungslos, wenn nicht eine viel intensivere Didaktisierung geleistet wird.
- Die Vorgabe, Aufgaben zu stellen, die echtes Sprachhandeln fordern, wird nicht eingelöst. Es überwiegen Aufgaben, die rein reproduktive Tätigkeiten verlangen, wie Ablesen, Zuordnen, Zusammenstellen von Äusserungen aus Listen, Vorlesen von Sätzen oder auswendig gelerntes monologisches Sprechen. Dies aber ist nicht echtes kommunikatives Handeln. Das Verbot von Rollenspielen und Simulationen engt die Möglichkeiten zum Erwerb von Kommunikationsfähigkeit zu stark ein.
- Der Wortschatzaufbau krankt daran, dass das Vokabular eines thematischen Feldes nicht systematisch aufgebaut, sondern über die Bände des Lehrmittels verstreut vorkommt. Unter schulischen Bedingungen kann sich deshalb der Grundwortschatz nicht konstruktivistisch aufbauen. Zudem werden zu wenige Nomen vermittelt.
- Fehlerhafte Äusserungen werden in den Unités als «funktionale Mehrsprachigkeit» akzeptiert, die Korrektheit wenig geübt. Hingegen wird in den Abschlussübungen (tâches) plötzlich korrekter Sprachgebrauch vorausgesetzt.
Fazit
Das der Politik vorgelegte Thesenpapier stützt sich also auf Studien, deren Wissenschaftlichkeit stark von positiven Hoffnungen und unzulässigen Manipulationen geprägt ist und einer ernsthaften seriösen Nachprüfung nicht standhalten. Es geht wohl in erster Linie darum, liebgewordene Positionen aufrecht zu erhalten, die inzwischen in verschiedener Hinsicht anfechtbar geworden sind.
Hier nun eine Aufzählung der Faktoren, die das Sprachenkonzept und den Frühfremdsprachenunterricht als falsches Konzept erkennen lassen:
- Die ÜGK schlüsselt auf, dass der Erfolg des Fremdsprachenunterrichts, insbesondere des Französischunterrichts, stark abhängt von den kognitiven Grundfähigkeiten der Kinder und Jugendlichen: Die Grundkompetenzen erreichen beispielswese in BS [7]:
| | | Grundniveau | erweitertes Niveau | Progymnasium |
| | Hörverstehen | 15% | 44% | 83% |
| | Leseverstehen | 8% | 27% | 80% |
Die Werte der anderen Kantone können dem Bericht Erzinger et al. entnommen werden. Diese Heterogenität in der Aufnahmemöglichkeit von Fremdsprachen wird von den Autorinnen und Autoren des Synthesepapiers in keiner Weise angeschnitten. Allenfalls ist die Rede von Massnahmen, die für die Schwächeren zusätzlich ergriffen werden müssten.
- Das Synthesepapier legt Wert auf den Unterricht in einer zweiten Landessprache als politisch notwendige Garantie für den Zusammenhalt der Nation. Angesichts der Tatsache, dass 40 – 50 Prozent des Jahrgangs der 15-Jährigen kein Französisch versteht, stellt sich die Frage, inwiefern dies tatsächlich die sieben Jahre Unterricht in der Fremdsprache rechtfertigt. Wäre gegenseitige Verständigung das Ziel, wäre vermutlich ein anderes Kommunikationsmittel nützlicher. Da Englisch in allen Landesteilen besser verstanden wird und offensichtlich grösseren Lernerfolg zeigt, könnte diese Lingua Franca zumindest bei den Schwächeren des Grundniveaus und der erweiterten Anforderungen die Verständigung im anderssprachigen Landesteil eher garantieren. Die Vermutung liegt nahe, dass hier einem nutzlosen Werkzeug magische Kräfte zugedacht sind, die dieses in Wirklichkeit gar nicht haben kann.
- Das Autorenteam des Synthesepapiers wünscht sich die Optimierung des Stufenübergangs von der Primar- in die Sekundarschule: «Allzu oft kommt es beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe zu Brüchen. Dies geschieht, wenn das bereits Erworbene vor allem als defizitär betrachtet und wieder “bei null begonnen” wird oder wenn nach einem kommunikativen Unterricht in der Primarstufe in der Sekundarstufe oder im Langzeitgymnasium plötzlich primär auf formale Aspekte fokussiert wird.»
Hier klingt ein ganz grundsätzliches Problem an, das die PH-Dozenten sträflich ignorieren: Die Bedingungen des Fremdsprachenlernens. Um auf etwas aufbauen zu können, muss eine Grundlage, irgendwelche sprachlichen Kenntnisse oder Handlungsmuster, vorhanden sein. Die Kolleginnen und Kollegen der abnehmenden Schulen stellen jedoch fest, dass da nichts vorhanden ist: wenig Hörverstehen, kein Leseverstehen, keine mündliche oder schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Mit anderen Worten: Bei einem grossen Teil der Übertretenden aus der Primarschule gibt es nichts «Erworbenes», das als «defizitär» betrachtet werden kann, wie die PH-Leute es sich vorstellen.
Der Grund liegt in einer Nichtbeachtung des menschlichen Gedächtnisses. Dies hat zwei wichtige unterschiedlich wirksame Funktionen beim Sprachenlernen: Das deklarative Gedächtnis nimmt Wissen über Sprache auf (Wörter, Satzmuster, semantische und grammatische Formen, Schreibweisen, kulturelles Wissen). Dieses Wissen braucht es, um sich die Sprache als bedeutungstragende Symbolstruktur zu erschliessen. Um die Sprache jedoch passiv und aktiv einsetzen zu können (Hör- und Leseverstehen, Sprechen, Schreiben) um also mit Sprache handeln zu können, muss dieses Wissen ins prozedurale Gedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis, überführt werden. Das heisst: Es muss automatisiert werden wie das Schuhebinden, das Autofahren. Unentwegtes Üben und Anwenden sind die Bedingung, um sprachlich «handlungsfähig» zu werden. Es muss ohne deklarative Anstrengung abrufbar werden. Erst dann gibt es etwas «Erworbenes».[8]
«Spracherwerb» so verstanden setzt allerdings intensive Gedächtnisarbeit voraus. Mit drei und zwei Wochenlektionen Französisch (oft noch als Doppelstunden im Pensum zusammengelegt) kann das zu Lernende nicht nachhaltig aufgenommen werden. Es wird sofort wieder vergessen. Bei der von den Autoren des Thesenpapiers favorisierten Lehrmethode wird diese Tatsache nicht beachtet. Das Resultat: Weder im deklarativen noch im prozeduralen Gedächtnis wird etwas verankert, was nutzbar wäre für einen aufbauenden Unterricht.
Deshalb ist die Frage «Frühfranzösisch» ja oder nein, nicht die entscheidende Frage. Wesentlich ist vielmehr die Intensität, mit der das Gedächtnistraining stattfinden kann. Bei Französisch, das für Deutschschweizer strukturell weiter entfernt ist als Englisch, sind fünf Wochenlektionen, verteilt auf fünf Tage, das Mindeste, was erforderlich ist, um Gedächtnisspuren dauerhaft zu legen.
Felix Schmutz

[2] Zbinden, Susanne: Leseverstehen mit altem und neuem Lehrmittel im Vergleich. Eine empirische Studie über das Verstehen von französischen Texten auf der Sekundarstufe 1. Universität Freiburg (CH), 2017.
[3] Wiedenkeller, Eva/ Lenz, Peter: Schlussbericht zum Projekt ‚Ergebnisbezogene Evaluation des Französischunterrichts in der 6. Klasse (HarmoS 8) in den sechs Passepartout-Kantonen‘, 2019.
[4] Erzinger, A. B., Angelone, D., Locher, F. M., Prosperi, O., Salvisberg, M.,
& Tomasik, M. J. (Hrsg.). (2025). Nationaler Bericht zu der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) 2023, Sprachen 11. Schuljahr: ein Beitrag zum Schweizer Bildungsmonitoring. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85368
[5] Berthele, R. (2019). Policy recommendations for language learning: Linguists’ contributions between scholarly debates and pseudoscience. Journal of the European Second Language Association, 3(1), 1–11. DOI: https://doi.org/10.22599/jesla.50
[6] Christian Henzi, Clin d’oeil - Ein Lehrmittel in der Kritik, Eine umfassende Analyse des Französisch-Lehrmittels auf Sekundarstufe 1, Masterarbeit, Eingereicht bei der pädagogischen Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), 2021.
[8] Lutz Jäncke. Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften, Zürich, 2024. Kapitel 14 – 16.
10.06.2025
Von bildungspolitischen Schlafwandlern
Seit Jahren kennt die Schweizer Volksschule von den Lernerfolgen her nur eine Tendenz: abwärts. Doch die Schweizer Bildungsdirektoren wollen weiterfahren wie bisher. Auch bei den frühen Fremdsprachen. Den deprimierenden Testresultaten zum Trotz. Ein Zwischenruf
«En Suisse on s’entend bien parce qu’on ne se comprend pas», sagen die Waadtländer: «In der Schweiz kommen wir gut miteinander aus, weil wir uns nicht verstehen.» Das welsche Scherzwort wird bittere Realität. Das zeigt die jüngste Sprachstudie der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). Die sogenannte Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK 2023) untersuchte die Sprachkompetenz von 18‘500 Jugendlichen am Ende der obligatorischen Schulzeit – in der Deutschschweiz Französisch als Fremdsprache und Deutsch als Schulsprache. (1)
Nach 500 Lektionen Französisch kaum ein Satz
Die Resultate dieses nationalen Sprachtests ernüchtern. Lediglich 51 Prozent der Schüler erreichen im Fach Französisch die Lese-Grundkompetenzen, also die niedrigste Könnensstufe beim Leseverstehen. Konkret: Sie begreifen einfachste Sätze wie «Où est la gare?». Die andere Hälfte ist damit bereits überfordert. In lernschwachen Klassen erreichen oft nicht einmal 10 Prozent dieses Grundniveau. Drastisch formuliert bedeutet das: Nach 500 Lektionen Französisch verstehen sie kaum einen Satz! Eine solche Bilanz ist verheerend – dies in einem Land, das den Mythos der Viersprachigkeit pflegt. Getröstet haben sich die Verantwortlichen, dass die Testergebnisse beim französischen Hörverstehen minim besser ausgefallen sind.
Eigentlich wissen wir es längst: Es steht nicht gut um die Sprachenkenntnisse der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz. Das Können sinkt, auch beim Leseverständnis deutscher Texte. Die jüngsten Ergebnisse bestätigen, was uns die PISA-Resultate seit 2012 zeigen: einen deutlichen Negativtrend. In den Grundlagenfächern gilt jeder vierte Schüler als «lernleistungsschwach», wie es in der Bildungssprache heisst. Konkret: Er kann nur ungenügend lesen, schreiben, rechnen. Seit Längerem warnt der Bildungsforscher Stefan C. Wolter, Universität Bern, vor dieser Abwärtsspirale. (2)
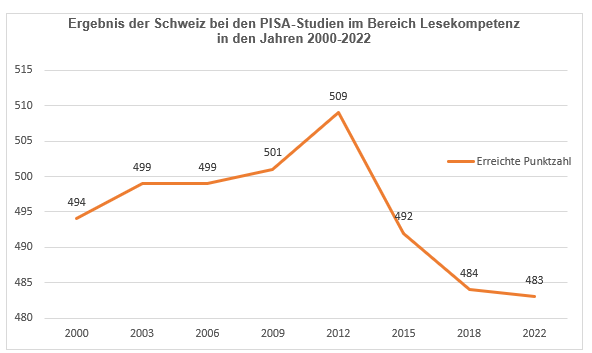
Wir wissen es seit Langem! Doch handeln?
Die Langzeitstudie der Zürcher Linguistin Simone Pfenninger «Beyond Age Effects» stellte den propagierten Wert der frühen Fremdsprachen früh infrage. (3) Auch Im Raum Zentralschweiz ist seit fast zehn Jahren klar, dass Französisch auf Primarschulstufe ungenügende Resultate erbringt. Die Fremdsprachenevaluation der Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz BKZ brachte es 2016 an den Tag. Dann wurden Förderprogramme entwickelt, und nun müssen die Verantwortlichen – oh Wunder! – feststellen, dass diese Massnahmen nichts gebracht haben.
Die Befunde wären klar, die Resultate eindeutig. Doch die bildungspolitische Karawane zieht weiter! Ungerührt und ungestört. Im bekannten EDK-Speech wird beschönigt: Alles halb so schlimm. Wir müssen nur da und dort etwas nachbessern – und eine weitere Studie in Auftrag geben. Auf gut Deutsch: Wir machen weiter wie bisher! Dies der Tenor von Christoph Darbelley (Die Mitte, VS), Präsident der EDK, und seinem Vize Armin Hartmann (SVP, LU) an der Pressekonferenz vom 22. Mai 2025. Sie glauben, sie stört kein Zweifel. Eine Umkehr kommt für die EDK-Verantwortlichen darum nicht infrage, eine Abkehr von den zwei frühen Fremdsprachen auf der Primarschulstufe scheint ausgeschlossen. Die Bildungspolitik verschliesst die Augen.
«Notfall» Klassenzimmer
Längst aufgegangen sind die Augen den Lehrerinnen und Lehrern im pädagogischen Parterre. Sie erfahren täglich, dass der Lehrplan 21 mit den zwei frühen Fremdsprachen auf der Primarstufe und der Fülle von Kompetenzen überladen ist. Und sie wissen: Wer die Fachinhalte ausdehnt, minimiert die Übungszeit. Beides lässt sich nicht gleichzeitig maximieren. Das Gesetz der Gegenbuchung! Darunter leiden vor allem der Kernbereich Rechnen und das Grundlagenfach Deutsch mit den Kulturtechniken Lesen und Schreiben. Das macht guten Lehrerinnen und engagierten Pädagogen zu schaffen. Sie hetzten von Thema zu Thema, beklagen manche – ohne die nötige Zeit zum Vertiefen und Üben, ohne genügend Freiraum fürs Erlebnis und das Musische. Das hat seinen Grund: Die Primarschule hat sich inhaltlich entgrenzt.
Dazu kommt, dass die angedachte Integration in dieser Form nicht recht funktioniert. Verhaltensauffällige Schüler belasten den pädagogischen Alltag. Der Wegfall der Kleinklassen als Folge der Integration ganz unterschiedlicher Kinder in die gleiche Lerngemeinschaft verstärkt die Unruhe im Klassenraum und erschwert den Unterricht. Ein geregeltes «Schule-Halten» ist manchmal kaum (mehr) möglich. Nicht umsonst spricht die NZZ vom «Notfall» Klassenzimmer.
Die Praxiserfahrung wird negiert
Der Mikrokosmos des pädagogischen Alltags und die Sphäre der Bildungsstäbe und der Verwaltung: zwei verschiedene Welten! Hier die Welt der Pädagoginnen – dort die Welt der Pädokraten. Gute pädagogische Praxis und eine praxisfremde Bürokratie generieren wechselseitig Störfaktoren.
Manche Praktiker haben sich immer gegen zwei frühe Fremdsprachen gewehrt. Ein Diskurs war schon damals fast unmöglich; heute ist er noch schwieriger geworden. Berufserfahrene Lehrer spüren: Ein kleiner universitär-akademischer Zirkel aus den Pädagogischen Hochschulen hat – im Verbund mit einer starken Bildungsbürokratie und den Verbänden – die Definitionsmacht über die Schulen übernommen. Diese Kreise bestimmen, was gelehrt und wie unterrichtet werden muss – oft auch gegen die Praktiker des pädagogischen Alltags. Das bedeutetet eine Marginalisierung der Praxisempirie.
Aufwachen, bitte!
Vielleicht gilt das waadtländische Bonmot auch für diese beiden Welten: «On s’entend bien parce qu’on ne se comprend pas.». Man kommt zwar irgendwie miteinander aus, aber man versteht sich nicht mehr. Das ist fatal. Nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer. Fatal ist es vor allem für schwächere und fremdsprachige Kinder. Sie werden mit der ersten Fremdsprache konfrontiert, bevor sie in der Schulsprache richtig lesen und schreiben können – geschweige denn Texte verstehen. Dass damit vor allem die Freude an der französischen Sprache verloren geht, verschlimmert die Sache noch.
Die Testresultate sind ernüchternd und machen hellhörig. Es wäre darum Zeit aufzuwachen. Schlafwandeln hat Folgen.
Carl Bossard
Ehemaliger Direktor der Kantonsschule Luzern
Gründungsrektor der Pädagogischen Hochschule Zug
(1) https://www.edk.ch/de/die-edk/news/mm22052025 [abgerufen: 24.05.2025]
(2) Sebastian Briellmann, «Wir sind im Blindflug». Interview mit Stefan Wolter, in: NZZ, 04.03.2025, S. 9
(3) Simone E. Pfenninger, David Singleton (2017), Beyond Age Effects in Instructional L2 Learning. Revisiting the Age Factor. Bristol: Multilingual Matters
07.06.2025
Teilzeitarbeit im Lehrberuf ist beliebt
Der Wunsch nach Teilzeitarbeit ist in den letzten Jahren immer wie mehr gestiegen. Vor allem der Lehrberuf ist dafür optimal ausgelegt. Dennoch gibt es insbesondere aus dem politisch bürgerlichen Lager Stimmen, die sich gegen sogenannte «Kleinpensen» (Anstellungen mit weniger als 20%) aussprechen. Eine kürzlich veröffentlichte Statistik des Kanton Basel-Landschaft zeigt auf, wie viele Lehrpersonen das Angebot der Teilzeitbeschäftigung nutzen.
Drei Viertel der Lehrpersonen arbeiten Teilzeit
Das Amt für Statistik des Kanton Basel-Landschaft veröffentlichte im vergangenen Monat Statistiken zum durchschnittlichen Beschäftigungsgrad von Lehrpersonen. Die Zahlen sprechen für sich: 73% der Lehrpersonen arbeiten Teilzeit, wobei darunter ein Arbeitspensum von weniger als 90% gezählt wird.
Auf der Primarstufe ist der Anteil Teilzeitarbeitende am grössten. Je höher die Bildungsstufe ist, desto geringer wird der Unterschied zwischen Teilzeit und Vollzeit. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass der Prozentanteil an weiblichen Lehrpersonen auf der Primarstufe im Vergleich zu den anderen Schulstufen am höchsten ist.
Familienplanung und Schwangerschaftspausen dürften ein wesentlicher Grund sein, weshalb der Anteil von Teilzeitarbeitenden auf der Primarstufe am höchsten ist.
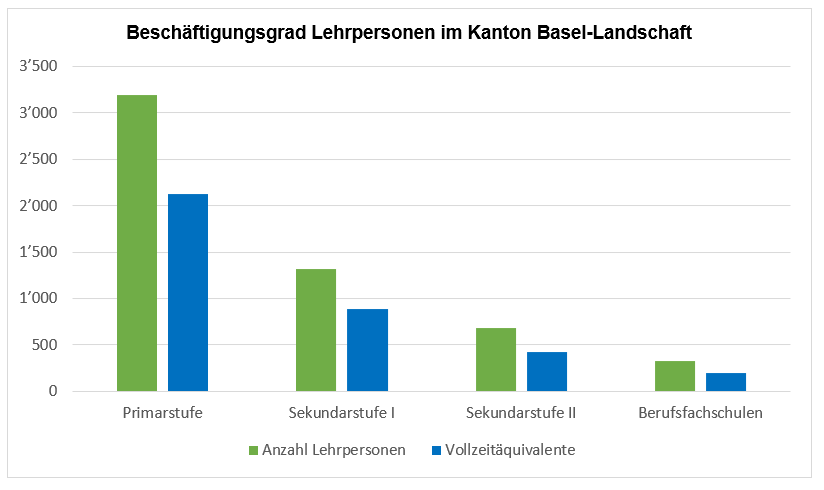
Attraktivitätssteigerung des Lehrberufs
Der Lehrberuf ist einer der Berufe, der sich sehr gut als Teilzeitjob eignet. Diese Möglichkeit trägt massgeblich zu einer Attraktivitätssteigerung des Berufs bei. Dass derart viele Lehrpersonen kein Vollpensum haben möchten, hat auch wesentlich mit der sehr hohen Belastung dieses Berufes zu tun. Die Burnout-Rate bei Lehrpersonen zählt zu den grössten.
Anahi Sidler
Sekretariat Starke Schule beider Basel
06.06.2025
Fast ein Fünftel erreicht in Deutsch die Grundkompetenzen nicht
Im kürzlich veröffentlichten Bericht zur Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) der 9. Klässler*innen wird deutlich: Nur knapp 80% der Lernenden erreichen in ihrer Schulsprache die Grundkompetenzen. Ein erschreckendes Resultat.
Bereits in mehreren Artikeln berichtet die Starke Schule beider Basel (SSbB) über die Resultate des nationalen Bildungsberichts. Nach der Analyse der Kompetenzen im Fach Französisch sowie dem Vergleich der beiden Fremdsprachen Französisch und Englisch konzentriert sich dieser Artikel auf die Leistungen in der Schulsprache. Für den Kanton Baselland ist die Schulsprache Deutsch.
Im Stadtkanton können mehr als 20% nur ungenügend Deutsch
Schweizweit erreichen nur 82% der Schüler*innen die Grundkompetenzen im Lesen in der Schulsprache. Während Baselland mit 83% knapp über dem Durchschnitt liegt, sind es im Stadtkanton lediglich 77%.
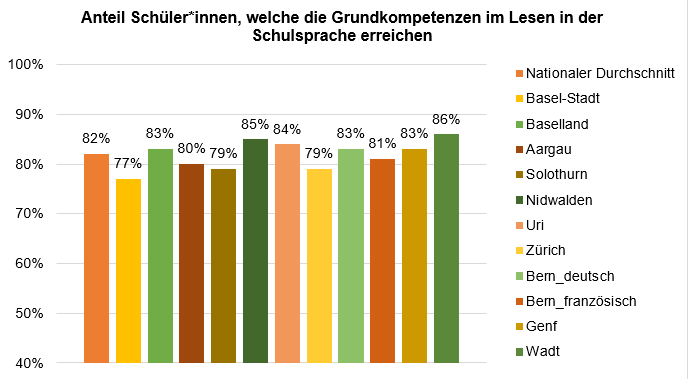
Im Kompetenzbereich Orthografie sieht es nur leicht besser aus: Baselland erreicht mit 87% einen Wert, welcher 3 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt, Basel-Stadt hingegen liegt mit 81% erneut deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 82%.
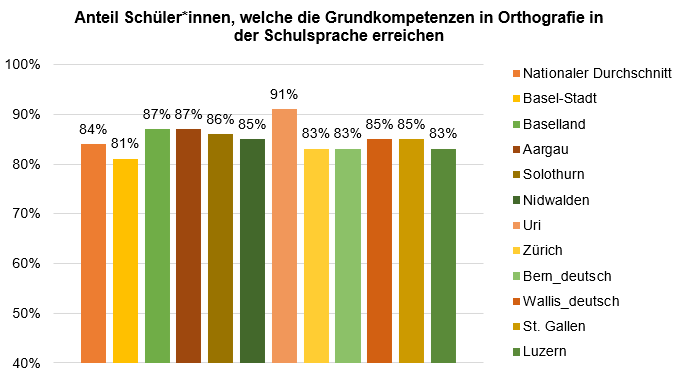
Deutsch als Fundament
Die Schulsprache zu beherrschen bildet das Fundament für die gesamte schulische Laufbahn. Nahezu in jedem Fach sind sprachliche Kompetenzen gefordert. Um so erschreckender ist das Resultat der ÜGK: Fast 20% der Schüler*innen können die Schulsprache nicht genügend gut.
SSbB begrüsst politisches Vorgehen
Um diesem Leistungsabbau entgegenzuwirken, muss die Schulsprache gefördert werden. Die mangelnde Qualität im Fach Französisch (als Fremdsprache) löst ebenfalls Bedenken aus und steht vermutlich im Zusammenhang mit den tiefen Leistungen im Fach Deutsch. Französisch überfordert, demotiviert und am Ende der obligatorischen Schulzeit erreichen nur rund die Hälfte der Schüler*innen die Grundkompetenzen. Dieses schlechte Resultat steht in keinem Verhältnis zum grossen Aufwand für das Fach. Würden diese Ressourcen stattdessen in das Fach Deutsch investiert, könnte man das Leistungsniveau im Fach Deutsch erhöhen.
Auf politischer Ebene findet die Ansicht der SSbB allmählich Gehör: Landrätin Anita Biedert reicht in der nächsten Landratssitzung einen politischen Vorstoss ein, welcher die Abschaffung des Frühfranzösischs fordert.
Lena Heitz
Vorstand Starke Schule beider Basel
05.06.2025 - Gastbeitrag
Höchste Zeit für ein Handyverbot an Schulen
Zufällige Begegnung an einem Food-Festival in Baden: Plötzlich steht da die Frau, die ein Verbot von Smartphones an der Aargauer Volksschule erlassen hat. Es ist die neue Bildungsdirektorin des Kantons, Martina Bircher (SVP). Eltern, die sie auf dem Festivalgelände erkennen, sprechen sie auf den Entscheid an, über den kurz davor im Lokalfernsehen und in der «Aargauer Zeitung» berichtet wurde. Mehrheitlich positiv seien die Reaktionen, sagt Bircher. Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt ein klares Resultat: «Überfällig» sei das Verbot, finden 81 Prozent von 3340 Abstimmenden auf dem Newsportal der AZ.
Der Aargau ist der erste grosse Kanton, der private Geräte wie Handys, Smartwatches und Tablets breitflächig aus dem Unterricht verbannt. Kurz davor war Nidwalden vorangegangen. Sie verhalten sich pionierhaft.
Bildung ist Sache der Kantone. Den Entscheid den Gemeinden oder den Schulen zu überlassen, ist nur schon deshalb nicht zielführend, weil an Oberstufenzentren Kinder aus mehreren Gemeinden zusammenkommen. Zudem ist der Aufwand, Hunderte verschiedene Reglemente zu erarbeiten, verschwendete Energie.
Der nun einsetzende Wandel – anderswo, etwa in Skandinavien, ging es schneller – ist eine Reaktion auf wissenschaftliche Erkenntnisse und Alltagserfahrungen, wie sie an wohl allen Schulen und in den meisten Familien gemacht wurden. Dafür gibt es fünf Hauptgründe:
1. Die Selbstregulierung ist gescheitert
Lange hiess es, Teenager sollten lernen, ihren Medienkonsum selbst zu kontrollieren. Solange Handys zum Telefonieren und Simsen dienten, funktionierte das. Die Idee entpuppte sich spätestens dann als Illusion, als Smartphones mit Selfie-Kameras auf den Markt und Plattformen wie Tiktok und Instagram auf jedes Kinderhandy kamen. Diese Apps sind perfide konstruierte Aufmerksamkeitsfallen, darauf angelegt, psychologische Schwächen auszunutzen. Big-Tech-Konzerne im Silicon Valley und in China haben genau dafür Milliarden investiert. Auch Erwachsene sind dagegen oft machtlos, aber bei ihnen gilt Eigenverantwortung – bei Teenagern braucht es Massnahmen zum Jugendschutz. Analog zu anderen Suchtmitteln wie Alkohol.
2. Psychische Gesundheit in der Krise
Die Zahl der depressiven Jugendlichen hat sich in den USA seit 2010 mehr als verdoppelt. In der Schweiz ist es weniger dramatisch, aber die Zahlen zeigen auch bei uns nach oben. Der amerikanische Sozialpsychologe Jonathan Haid – dessen Buch «Generation Angst» mittlerweile als Standardwerk gilt – zeigt, dass der Kipppunkt exakt mit dem Siegeszug des Smartphones zusammenfällt. Der Zusammenhang ist nicht nur statistisch auffällig, sondern auch plausibel: Wer sich nachts durch Videos scrollt, statt zu schlafen, wer sich pausenlos mit den scheinbar perfekten Leben anderer vergleicht, verliert in der Pubertät schnell mal das Gleichgewicht.
3. Die Bildung ist gefährdet
Die Schule ist ein Ort des Lernens und nicht der ständigen Ablenkung. Konzentrationsfähigkeit, Verstehenwollen und Durchhaltewille leiden, wenn der nächste Dopamin-Kick nur einen Fingertipp entfernt ist. Lehrerinnen und Lehrer berichten, dass sich Jugendliche kaum mehr fünf Minuten am Stück auf eine Aufgabe konzentrieren können, ohne zum Handy zu greifen. Die Folge: eine schleichende Zerstörung des Bildungsauftrags.
4. Eltern brauchen Entlastung
Oft wird als Argument gegen ein Verbot angeführt, die Verantwortung für den Umgang mit dem Handy liege bei den Eltern. Doch wenn ein Kind ohne Smartphone in die Schule kommt, andere es aber mitnehmen dürfen, entsteht Ungleichheit, die zu Konflikten führt. Der Gruppendruck ist enorm, und viele Eltern kapitulieren. Ein kantonales Verbot ist eine Entlastung. Die Verantwortung wird nicht abgeschoben, sondern sinnvoll verteilt: Die Schule regelt den Schulalltag, die Eltern bleiben für die Freizeit zuständig.
5. Schutz vor Cybermobbing
In der Schweiz haben 57 Prozent der 12- bis 19-Jährigen in den letzten zwei Jahren erlebt, dass sie via Smartphone beschimpft oder beleidigt wurden (James-Studie von 2024). Auch tragische Fälle mit schwerwiegenden Folgen sind dokumentiert. Dieses Problem wird durch ein Smartphone-Verbot an Schulen nicht gelöst, aber zumindest reduziert.
Allein der letztgenannte Grund müsste reichen, Einschränkungen durchzusetzen. Welche Kantone begreifen die Notwendigkeit als nächste?
Patrik Müller
Chefredaktor CH Media, Zentralredaktion und «Schweiz am Wochenende»
[Quelle:
bz vom 04.06.2025, abgedruckt mit Erlaubnis des Autors]
02.06.2025
Politischer Vorstoss: Abschaffung Frühfranzösisch
An der nächsten Landratssitzung reicht Landrätin Anita Biedert einen politischen Vorstoss ein, der die Abschaffung des Frühfranzösisch auf der Primarstufe fordert. Neu soll der Französischunterricht erst in der Sekundarschule I beginnen.
Förderung von Deutsch und Mathematik in der Primarstufe
Der Französischunterricht soll abgeschafft werden, damit mehr Resourcen für die Fächer Deutsch und Mathematik geschaffen werden. Zudem sollen fremdsprachige Kinder, welche über zu wenig Deutschkenntnisse verfügen, zusätzliche Lektionen erhalten.
Der Text des Vorstosses hat folgenden Wortlaut:
"Der nationale Bericht zur Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) der Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen in den Sprachen im Jahr 2023 ist vor Kurzem veröffentlicht worden. Die Ergebnisse präsentieren ein völlig unbefriedigendes Bild. Die Situation ist besorgniserregend, insbesondere in der Fremdsprache Französisch: Beinahe die Hälfte der Schülerinnen und Schüler erreicht bis zum Ende der obligatorischen Schule in Französisch die Bildungsziele nicht. In Englisch sind die Ergebnisse deutlich besser (siehe folgende Grafik).
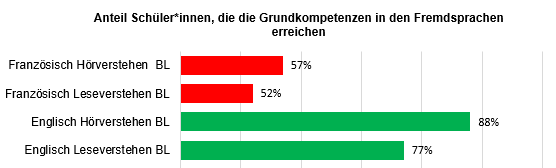
Grafik: Quelle: Französischkompetenzen sinken kontinuierlich
Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) reagiert mit grossen Bedenken und zeigt sich bekümmert ob der unzureichenden Resultate im Fach Französisch. Er rät, das Zwei-Fremdsprachen-Modell an der Primarschule zu überdenken.
Bezugnehmend auf die Motion vom 20.10.2022 «Verzicht auf Französischunterricht an der Primarschule» ersuche ich den Regierungsrat, den Fokus beim Fremdsprachenkonzept an der Primarschule auf mehr Qualität als Quantität zu richten. Als Folge der sehr schlechten Resultate im Fach Französisch drängt sich ein zeitnahes Handeln auf, zumal diese Fremdsprache bei vielen Schulkindern Frust und Demotivation auslöst. Dies wird der französischen Sprache nicht gerecht, eine Verschiebung auf die Sekundarschule I könnte diesem Umstand Abhilfe verschaffen. Die Schülerinnen und Schüler würden mit völlig anderen Voraussetzungen (positive Einstellung zum Lernen einer Fremdsprache durch die Erfahrung aus dem Englischunterricht) und Freude diese Landessprache angehen.
Im Sinne einer Primarschule, die den Kernfächern Deutsch und Mathematik die nötige Sorgfalt zukommen lässt, ersuche ich den Regierungsrat, folgenden Antrag schnellstmöglich umzusetzen.
Die Regierung wird gebeten, eine Vorlage auszuarbeiten, mit welcher auf Gesetzesebene festgelegt wird, dass auf der Primarstufe nur Englisch als Fremdsprache unterrichtet wird. Der Französischunterricht beginnt erst auf der Sekundarstufe I. Allfällige Verträge und Konkordate, welche diese Umsetzung tangieren, sind zu kündigen."
Zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe werden immer häufiger kritisiert
Nicht nur die SSbB und der LCH fordern das Überdenken von zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe, sondern zunehmend auch Pädagoginnen und Pädagogen. Sowohl in der Politik als auch in Bildungskreisen wächst die Kritik an zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe, zumal Studien und Berichte regelmässig das Scheitern von Frühfranzösisch aufzeigen. Das Motto "je früher, desto besser" trifft auf den Fremdsprachenbeginn jedenfalls nicht zu.
Charlotte Höhmann
Vorstoss Starke Schule beider Basel
02.06.2025
Französischkompetenzen sinken kontinuierlich
Vor Kurzem ist der nationale Bericht «Überprüfung der Grundkompetenzen ÜGK» veröffentlicht worden, der aufzeigt, wie gut die Sprachkenntnisse und Bildungsziele am Ende der obligatorischen Schulzeit in den beiden Fremdsprachen Französisch und Englisch erreicht wurden. Der Bericht bringt bedenkliche Ergebnisse hervor, speziell im Fach Französisch. Die Leistungen sinken kontinuierlich.
Durch die ÜGK werden die grundlegenden sprachlichen Kompetenzen in den Schulsprachen schweizweit überprüft und verglichen.
Folgend ein Vergleich zwischen den beiden Basler Halbkantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, sowie zwischen den beiden Fremdsprachen Französisch und Englisch.
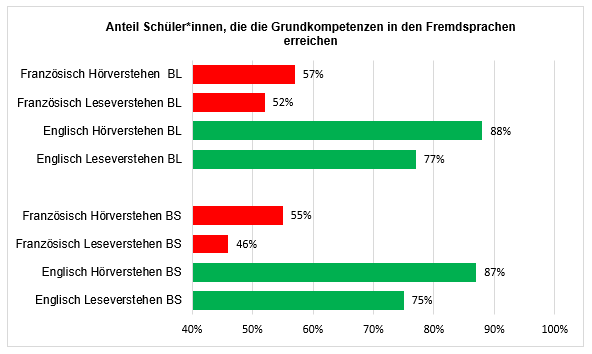
Auffallend ist, fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler erreichen die Bildungsziele im Fach Französisch nicht. Im Englisch hingegen liegt die Quote deutlich höher.
Dieses Ergebnis kann damit in einen Zusammenhang gebracht werden, dass Englisch zum einen generell als die einfachere Sprache gilt und zum anderen, dass die Jugendlichen in ihrem Alltag täglich und somit deutlich mehr mit Englisch konfrontiert werden, als mit Französisch. Von Social Media bis hin zur Musik oder Gaming, die Basissprache dafür ist English, was Englisch bei den Jugendlichen beliebter macht.
Motion wird eingereicht
Die SSbB begrüsst, dass bei der nächsten Landratssitzung eine Motion eingereicht wird, welche die Abschaffung von Frühfranzösisch auf der Primarstufe fordert, was eine Entlastung der Schüler*innen, wie auch eine Reduktion des Frusts und der Demotivation gegenüber dem Französisch zur Folge haben sollte.
Durch den Wegfall von 10 Jahreslektionen Französisch werden Ressourcen geschaffen, die es ermöglichen, die Fähigkeiten und Kompetenzen in anderen Fächern zu verbessern, insbesondere in Deutsch und Mathematik. Zudem könnten Schüler*innen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, zusätzliche Deutschlektionen erhalten oder begabte Schüler*innen auf freiwilliger Basis eine weitere Landessprache erlernen.
Lavinia Beck
Sekretariat Starke Schule beider Basel
01.06.2025 - Gastbeitrag
Informatik fällt unter den Tisch
Die WEGM-Reform in Baselland (Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität) schien zunächst ganz vernünftig. Doch dann wurde das Profil Informatik sang- und klanglos gestrichen.
Ein guter Start
Die Umsetzung der Reform begann in der ersten Vernehmlassung ganz gut: Die zwingenden Vorgaben wurden umgesetzt und die Anpassungen, die sich in den 30 Jahren seit den letzten Änderungen an der gymnasialen Matur förmlich aufdrängten, waren adressiert: neues Maturprofil PPP (Psychologie, Pädagogik, Philosophie) und ein Maturprofil Informatik nebst Informatik als Grundlagenfach. Einziger Haken: Das Profil Informatik wurde mit "Physik und Anwendungen der Mathematik" zu einem Mischprofil verquirlt. Das Fach "Anwendungen der Mathematik" würde wegfallen, wodurch künftige Studierende der mathematischen Naturwissenschaften aus BL massiv benachteiligt gewesen wären, auch weil zudem eine Reduktion der Mathematiklektionen geplant war. Die betroffenen Lehrpersonen waren alles andere als glücklich und das wurde in der Vernehmlassung auch so gemeldet.
Und dann: In Luft aufgelöst
In der zweiten Vernehmlassungsversion von diesem Frühjahr war dann das Profil Informatik verschwunden. Ohne Grund. Ohne Argumentation, weshalb man es sich leisten können soll, den Interessierten einen gründlichen Einblick in die wohl wichtigste Technologie des 21. Jahrhunderts zu verwehren. Für die Einführung von PPP wurde ausdrücklich auf den Lehrpersonenmangel verwiesen – der seit Jahrzehnten bestehende Mangel bei Informatikerinnen und Informatikern ist aber anscheinend kein Grund zum Handeln. Dabei wäre das Profil Informatik recht einfach umzusetzen: Mathematik gemeinsam mit dem Physikprofil und statt der dortigen Vertiefungsmathematik (AM) und den Mehrlektionen in Physik: Informatik. Zudem könnte man das Profil auch nur an denjenigen Gymnasien führen, die es anbieten können und wollen.
Dr. Alain Gremaud, Gymnasiallehrer
| Dr. Alain Gremaud ist seit 2011 Lehrperson in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik am Gymnasium Münchenstein. Davor war er rund 20 Jahre in der Informatikbranche tätig. |
26.05.2025
Fremdsprache Französisch erreicht weiteren Tiefpunkt
Lange musste die Öffentlichkeit warten: Der nationale Bericht zur Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) der 9. Klässler*innen in den Sprachen (Schulsprache, zweite Landessprache und Englisch) im Jahr 2023 ist erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Die Ergebnisse sind bedenklich. Das Leistungsniveau der Schüler*innen sinkt in der Fremdsprache Französisch stetig.
Die ÜGK überprüfte gesamtschweizerisch die Grundkompetenzen in der Schulsprache (Deutsch, Französisch und Italienisch) sowie in der ersten und zweiten Fremdsprache am Ende der Sekundarstufe 1.
Fast die Hälfte erreicht in der Fremdsprache Französisch die Bildungsziele nicht
In Kantonen, in welchen Französisch als Fremdsprache unterrichtet wird, erreichen am Ende der Sekundarstufe 1 im Hörverstehen lediglich 58% die Grundkompetenzen, im Leseverstehen sind es sogar nur 51%. Beim Hörverstehen liegt Baselland mit 57% unter dem schweizweiten Durchschnitt; beim Leseverstehen ist der Wert mit 52% knapp darüber.
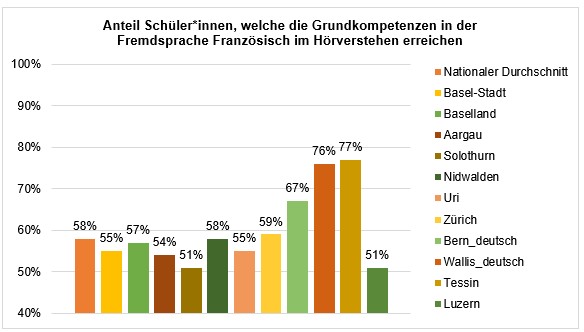
Im Leseverstehen sind die Werte noch tiefer.
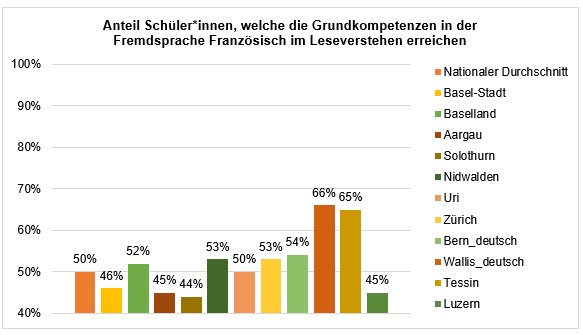
Deutlich besser sieht es im Fach Englisch aus. Baselland erreichen im Hörverstehen 88% der Schüler*innen die Grundkompetenzen und im Leseverstehen 77%. Basel-Stadt erreicht mit 87% im Hörverstehen immerhin einen Wert über dem nationalen Durchschnitt von 85%.
Ergebnisse haben politische Konsequenzen
Dass im nationalen Durchschnitt fast die Hälfte der Schüler*innen am Ende der obligatorischen Schulzeit im Leseverstehen der Fremdsprache Französisch die Grundkompetenzen nicht erreichen, ist brisant.
Bereits vor einiger Zeit hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden entschieden, Frühfranzösisch an den Primarschulen abzuschaffen. In mehreren anderen Kantonen laufen entsprechende Diskussionen, so auch in Baselland. Landrätin Anita Biedert (Mitglied der Starken Schule beider Basel) hat bereits vor einigen Monaten einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. Regierungsrätin und Bildungsdirektorin Monika Gschwind erklärte sich anlässlich der Parlamentsdebatte bereit, den Vorstoss zu prüfen.
Und auch beim Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) tut sich etwas: Ein Umdenken ist im Gange. Lange verteidigte Dagmar Rösler, Präsidentin des LCH, Frühfranzösisch als essentiell wichtig. Nun sagte sie gegenüber der NZZ: «Die Resultate sind beunruhigend und ein Hinweis darauf, dass Anpassungen vorgenommen werden müssen.» Die Frage muss gestellt werden, ob das Zwei-Fremdsprachen-Modell an der Primarschule noch zeitgemäss ist, so Rösler.
Französisch löst bei den Primarschüler*innen Frust und Demotivation aus
Fähigkeit und Wissen am Ende der Primarschulzeit stehen in keinem Verhältnis zum enormen Aufwand, welches fürs Fach Französisch an den Primarschulen betrieben wird. Die zeitlichen und finanziellen Ressourcen sind enorm und gehen zulasten der anderen Fächern. Insbesondere in Deutsch und Mathematik können die Lernziele als Folge zunehmend weniger gut erreicht werden.
An den Primarschulen des Kantons Basel-Landschaft erhalten die Schüler/-innen insgesamt 10 Jahreslektionen Französisch. Würden diese Lektionen in andere Fächer investiert, könnte das Bildungsniveau in Deutsch und Mathematik bis zum Ende der Primarschulzeit verbessert werden.
Hinzu kommt, dass in den beiden Basler Halbkantonen viele Primarschüler*innen eine andere Muttersprache haben als Deutsch. Die beiden Fremdsprachen Englisch und Französisch führen bei diesen Schulkindern häufig zu einer Überforderung.
Motion oder Parlamentarische Initiative in Baselland geplant
Am 12. Juni doppelt Biedert mit einer Motion oder einer Parlamentarischen Initiative im Landrat nach. Auf Anfrage der SSbB sagt Biedert zum Frühfranzösisch: «Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Der pädagogische Wert ist gering, die Frustration gross.» Immer offenkundiger wird das Scheitern dieser unbeliebten Fremdsprache. «Frühfranzösisch ist derart in der Kritik, es muss aus der Stundentafel der Primarschule gestrichen werden.»
Klare Position der SSbB
Zwei Fremdsprachen an den Primarschulen ist eine zu viel. Am Ende der Primarschulzeit können die Schulkinder kaum ein Wort Französisch reden. Sie sind frustriert und demotiviert. Französisch ist längstens zum unbeliebtesten Fach geworden.
Die SSbB fordert die Bildungsdirektion auf, wie in Appenzell Ausserrhoden die Notbremse zu ziehen und Französisch an den Primarschulen zu streichen. Dazu wird auch ein Austritt aus dem längst gescheiterten Harmos-Konkordat notwendig sein, weil dieses für die Harmos-Kantone zwei Fremdsprachen an den Primarschulen vorsieht.
Lena Heitz
Vorstand Starke Schule beider Basel
22.05.2025
Neue Betreiberin für Uni-Mensen
An der Universität Basel wechselt die Betreiberschaft der Mensen in der Bernoullistrasse, im Biozentrum sowie der Cafeteria im Kollegiengebäude: Nach der Zürcher SV Group übernimmt die britische Firma Compass Group die Verpflegung der Basler Studierenden. Die Übergabe der Mensen startet in den kommenden Wochen bis Ende Juni.
Bereits jetzt ist die Compass Group unter anderem für die Verpflegung der Studierenden an der ETH Zürich und der EPFL in Lausanne verantwortlich und gehört mit – laut eigener Aussage – über 150 Betrieben zu den zehn grössten Restaurantketten der Schweiz. 2023 erzielte die Firma einen Umsatz von 157 Millionen Franken.
Fleischloses Angebot muss erweitert werden
Gegenüber der bz teilte Uni-Sprecher Matthias Geering mit: «Die bisherigen Verpflegungsangebote sowie die Preise werden bestehen bleiben, dazu sollen neue Angebote geschaffen werden.» Ausserdem legte die Uni Basel fest, dass die neue Mensabetreiberin beim Tagesangebot ab Mitte 2026 einen fleischlosen Anteil von mindestens 60 Prozent anbieten muss. Fleisch, Milch und Eier müssen schweizerischen Ursprungs entstammen sowie Fische und Meeresfrüchte aus nachhaltigen Fischereien sein.
Vielfalt ist wichtig
Die neue Massnahme zur Reduktion des Fleischkonsums erachtet die SSbB als sinnvoll, da übermässiger Fleischkonsum weniger gesund ist und zusätzlich die Umwelt belastet. Ein vielfältiges und gesundes Angebot in den Mensen ist daher wichtig. Dies kann nun mit der neuen Betreiberin und den künftig geltenden Vorschriften umgesetzt werden. Auch die gleich gross bleibenden Preise werden sicherlich viele Studierende erfreuen.
Lena Heitz
Vorstand Starke Schule beider Basel
20.05.2025 - Gastbeitrag
Gymnasium ohne Vielfalt?
Die Umsetzung des neuen Mautritätsanerkennungsreglements (MAR) im Kanton Basel-Landschaft (WEGM) verbannt Russisch, aus dem Schwerpunktfächerkatalog. Weshalb das keine gute Idee ist.
Russisch hat Tradition in BS und BL
Die schweizweit ersten Russischkurse wurden an der Universität Basel vor 100 Jahren von der Russlandschweizerin, Altphilologin und später Slavistin, Elsa Mahler, gegeben. Als erste Frau bekam sie den Titel einer Professorin in Basel verliehen. Der Russischunterricht an den Mittelschulen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen. Im Kanton BL wurde Russisch als SPF zum ersten Mal nach der MAR-Reform von 1995 angeboten. Seit 2009 bietet das Gymnasium Münchenstein als einzige Schule Russisch als Schwerpunktfach an und deckt damit den gesamten Bildungsraum Nordwestschweiz ab.
Russisch ist mit den universitären Studiengängen vernetzt
Unser Russischunterricht ist propädeutisch und interdisziplinär ausgerichtet. Neben dem reinen Spracherwerb enthält er wertvolle Vertiefungen in Sprachwissenschaft, Geschichte, Geografie, Kunst und Politik. Das Fach kann nicht nur neue Denkräume eröffnen. Seit drei Jahren entdecken wir das Baltikum im Rahmen von Profilreisen und Projekten.
Wir stehen in engem Austausch mit dem Profilbereich Osteuropa der Universität Basel sowie mit anderen Universitäten, an denen Osteuropa-Studiengänge oder Slavistik angeboten werden. Die universitäre Expertise fliesst in unseren Unterricht ein. Und unsere Maturandinnen und Maturanden stellen die neuen Studierenden der philologischen Fächer und der Geschichte. Umso fassungsloser sind wir, wenn wir hören, dass die aktuelle Reform den Sprachfächern ihren propädeutischen Wert abspricht.
Russisch macht fit für das Leben
Wir bilden junge Menschen aus, die sich im osteuropäischen und postsowjetischen Raum auskennen und sprachlich-kulturell bewegen können. Für viele Absolventinnen und Absolventen erweist sich dies als bedeutende Qualifikation im Studium und in ihrem späteren Berufsleben. Die Kenntnis der russischen Sprache, Kultur und Geschichte wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis und die Handhabung geopolitischer und anderer Prozesse und Herausforderungen bleiben.
Kleine Fächer fördern Vielfalt
In den Diskussionen zum Schwerpunktfächerkatalog stehen in unserem Kanton wirtschaftliche Argumente an erster Stelle. Dies führt zwangsläufig zur Angebotsverarmung und schmälert unsere Konkurrenzfähigkeit in der Region und schweizweit. Unserer Meinung nach geht Bildungsgerechtigkeit nur über Wahlfreiheit, also über ein möglichst diversifiziertes und individuell erkennbares Angebot an den kantonalen Gymnasien, wo auch kleine Fächer wie Russisch und Griechisch Platz haben. Die Vielfalt in der Gesellschaft geht nicht ohne Vielfalt in der Bildung.
Fachschaft Russisch am Gymnasium Münchenstein
Maria Chevrekouko und Dr. Elena Rieder-Zelenko
15.05.2025
Baselland verabreicht Kindern am zweitmeisten ADHS-Medikamente
Die Menge an abgegebenen Medikamenten zur Behandlung von ADHS stieg in den letzten Jahren immer weiter an. Die neusten Zahlen des Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) zeigen die Zunahme deutlich. Im Kanton Basel-Landschaft wurden im Jahr 2023 bei Kindern und Jugendlichen schweizweit am zweitmeisten Medikamente verschrieben – mehr als doppelt so viele wie noch acht Jahre zuvor.
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine Beeinträchtigung, welche die Symptome Unaufmerksamkeit, Konzentrationsschwierigkeit und/oder Hyperaktivität und Impulsivität umfasst. Nicht selten ist in diesen Fällen ein konzentriertes Arbeiten in der Schule nur beschränkt möglich und die schulische Entwicklung gefährdet.
Die Verschreibung von Medikamenten zur Behandlung von ADHS erfolgt durch Fachpersonen und sollte mit engmaschiger Betreuung verbunden sein.
Aussagekräftige Studie mit nachdenklichen Resultaten
Die Zahlen von Obsan umfassen lediglich die Anzahl ADHS-Medikamente, welche jedes Jahr durch die Grundversicherung abgerechnet werden. Nicht enthalten sind die Leistungen der Invalidenversicherung (IV). Ausserdem wurden ausschliesslich Daten der ambulanten Leistungserbringer aufgenommen, da die Daten betreffend Abgabe im stationären Bereich unvollständig sind.
In der Studie wurde als Messwert die Standard-Tagesdosis einer erwachsenen Person (Defined Daily Doses, DDD) pro 1000 Einwohner*innen verwendet um einen Vergleich zu schaffen. Die Anzahl betroffener Personen lässt sich daraus aber nicht ablesen, da die verschriebene Dosis aufgrund von Alter, Geschlecht und Schwere der Beeinträchtigung unterschiedlich ist. In der Erfassung wurde zwischen Kinder & Jugendlichen sowie Erwachsenen unterschieden.
Die folgende Grafik zeigt den Vergleich der 26 Kantone betreffend Abgabe von ADHS-Medikamenten an Kinder & Jugendliche.
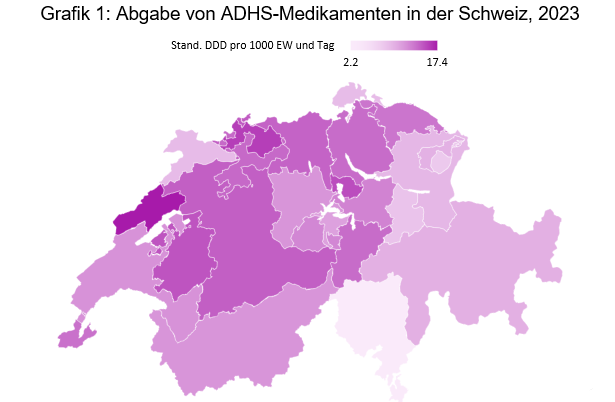
Mit Abstand am meisten Medikamente (17.4 DDD/1000 EW + Tag) wurden im Kanton Neuenburg abgegeben. Der Kanton Basel-Landschaft steht jedoch bereits an zweiter Stelle. Mit einem Wert von 14.7 DDD/1000 EW + Tag liegt dieser klar über dem schweizerischen Durchschnitt von 10.3. Im Gegenzug dazu bildet das Tessin mit einem Wert von 2.2 DDD/1000 EW + Tag deutlich das andere Ende des Abgabe-Spektrums ab.
Interessant ist auch der Vergleich des Kantons Basel-Landschaft zwischen 2015 und 2023: Während 2015 der Wert mit 6.0 noch klar unter dem damaligen schweizerischen Durchschnitt (6.6 DDD/1000 EW + Tag) liegt, steigt die Abgabe von ADHS-Medikamenten bis 2023 um 145% (14.7 DDD/1000 EW + Tag) – also fast zweieinhalbmal so viel. (siehe Grafik 2, violette Kurve)
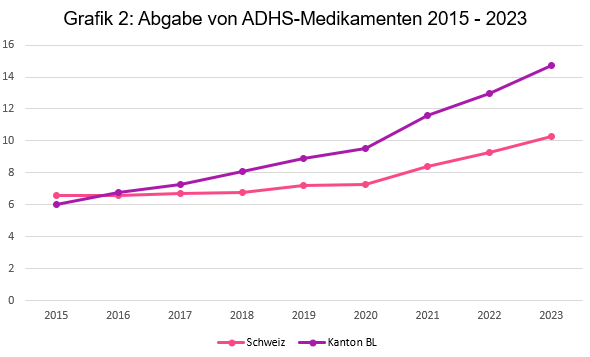
Die Anzahl schweizweit abgerechneter Medikamente blieb zwischen 2015 und 2020 relativ stabil, danach nahm diese ebenfalls stark zu. Und auch in Baselland ist ab diesem Jahr eine starke Zunahme zu verzeichnen.
Laut Obsan ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Interpretation der Daten, dass «die Psychiatrieversorgung in der lateinischen Schweiz stärker auf ambulante Angebote fokussiert, während in der deutschsprachigen Schweiz die stationäre Versorgung in psychiatrischen Kliniken sowie in psychiatrischen Abteilungen von Allgemeinspitälern eine grössere Rolle spielt». [1] Es kann davon ausgegangen werden, dass der tatsächliche Wert des Kantons Baselland - wenn man die stationären Abgaben einbeziehen würde - deutlich höher liegt. Der lateinische Kanton Neuchâtel läge somit im Verhältnis tiefer. Um eine fundierte Aussage zu treffen, fehlen jedoch exakte Daten.
Hohe Zunahme ist kaum erklärbar
Die genaue Anzahl an betroffenen lässt sich aus den Daten von Obsan nicht exakt ablesen. Gleichwohl kommt die Frage auf, ob sich die Anzahl Beeinträchtigung von ADHS tatsächlich zunehmend verbreitet. Fachpersonen gehen davon aus, dass es sich nicht um einen Anstieg an effektiv erkrankten Personen handelt, sondern sich vielmehr die Anzahl der Diagnosen sowie Verschreibungen für Medikamente erhöhen. Eine weitere Vermutung ist, dass in den letzten Jahren häufiger Mädchen und Erwachsene die Diagnose ADHS erhalten, welche früher aufgrund von anderer Symptomen unentdeckt blieb.
Auf Anfrage der SSbB, wie sich die Gesundheitsdirektion die hohe Anzahl abgegebener Medikamente erklärt und ob sie Handlungsbedarf sieht, nahm die Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirektion (VGD) des Kantons Basel-Landschaft ausweichend Stellung und verwies an die Ärztinnen und Ärzte: «Die Verschreibung bzw. Abgabe von Arzneimitteln (inkl. ADHS-Medikamente) erfolgt in alleiniger Verantwortung des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin bzw. der abgabeberechtigten Apothekerin oder des abgabeberechtigten Apothekers.» Eine Erklärung für die hohen Zahlen im Kanton BL könne die VGD somit nicht geben.
Lena Heitz
Vorstand Starke Schule beider Basel
13.05.2025
Verwarnungen – ein Rechtsproblem nun im Fokus der Politik
Seit einer Gesetzesänderung im Kanton Basel-Landschaft häufen sich fragwürdige Verwarnungen gegen Lehrpersonen. Die Starke Schule beider Basel (SSbB) hat bereits mehrmals darüber berichtet. Eine Interpellation im Landrat fordert nun Klarheit und Rechtsschutz.
Wachsende Besorgnis im Schuldienst
Seit der Gesetzesänderung vom 1. August 2024 mehren sich im Kanton Basel-Landschaft Berichte über fragwürdige und teilweise missbräuchliche Verwarnungen oder zahlreiche Verwarnungsandrohungen durch Schulleiter/-innen gegen Lehrpersonen. Diese Entwicklung sorgt für Unruhe, da schriftliche Verwarnungen nicht nur disziplinarische, sondern auch weitreichende berufliche und persönliche Folgen haben können. Besonders im sensiblen Schulalltag, wo Vertrauen und Kontinuität zentral sind, wiegen solche Massnahmen schwer.
Interpellation fordert Antworten
Landrätin Simone Abt (SP) hat am vergangenen Donnerstag mit einer Interpellation die Problematik der nicht anfechtbaren schriftlichen Verwarnungen nach § 15 Abs. 3 lit. c der Baselbieter Personalverordnung (SGS 150.11) aufgegriffen. Sie kritisiert, dass Verwarnungen gemäss Personalgesetz und -verordnung erteilt werden können, ohne dass Betroffene diese rechtlich anfechten dürfen. Dies stehe im «Spannungsverhältnis zum verfassungsmässigen Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz (Art. 29a BV)», wie Abt betont, zumal Verwarnungen oft die Vorstufe zu einer Kündigung sind und das Vertrauensverhältnis am Arbeitsplatz, insbesondere in Schulen, nachhaltig schädigen. Selbst wenn eine Kündigung später gerichtlich aufgehoben wird, «kann die persönliche und berufliche Integrität der betroffenen Angestellten nicht oder nur schwer wiederhergestellt werden», so Abt weiter.
Die Fragen aus der Interpellation an den Regierungsrat im Wortlaut
- Welche rechtlichen und sachlichen Überlegungen führten zur Regelung in § 15 Abs. 3 der Personalverordnung, wonach schriftliche Verwarnungen nicht anfechtbar sind – trotz deren möglicher kündigungsrelevanter Wirkung?
- In welchem politischen und administrativen Kontext wurde § 15 Abs. 3 der Personalverordnung eingeführt, und wie wurde dabei die Rechtsweggarantie gemäss Art. 29a BV berücksichtigt?
- Wie wird die Anfechtbarkeit schriftlicher Verwarnungen in anderen Kantonen geregelt, ins-besondere mit Blick auf den Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz gemäss Art. 29a BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK?
- Welche faktischen Möglichkeiten haben kantonale Mitarbeitende heute, um sich gegen eine Verwarnung zu wehren, wenn diese sich als unbegründet oder schädlich erweist – insbesondere in sensiblen Berufsfeldern wie dem Schuldienst?
- Erwägt der Regierungsrat, § 15 Abs. 3 der Personalverordnung dahingehend anzupassen, dass betroffene Mitarbeitende künftig eine schriftliche Verwarnung mit Einsprache oder Beschwerde anfechten können, um einen verfassungsrechtlich wirksamen Rechtsschutz zu gewährleisten?
- Welche Massnahmen trifft der Regierungsrat, um sicherzustellen, dass Verwarnungen nur unter Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen und nicht als informelles Führungsinstrument zur Disziplinierung eingesetzt werden?
Basel-Landschaft als Sonderfall
Die Regelung im Kanton Basel-Landschaft, dass schriftliche Verwarnungen – selbst solche mit Verfügungscharakter, die stark in die Rechtsstellung der Betroffenen eingreifen – nicht anfechtbar sind, scheint schweizweit einzigartig zu sein. Während in anderen Kantonen die Anfechtbarkeit von Verwarnungen oft gewährleistet ist, um den Rechtsschutz gemäss Art. 29a BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK zu sichern, bildet Basel-Landschaft mit einem expliziten Paragraphen zum Verbot der Anfechtbarkeit von Verwarnungen offenbar eine Ausnahme. Derzeit laufen Abklärungen, um die Rechtslage in den anderen Kantonen genauer zu analysieren.
Dringende Forderung nach Anpassung der Gesetzesgrundlage
Die SSbB unterstützt die Anliegen der Interpellation und fordert, dass Verwarnungen gegen Lehrpersonen rechtlich anfechtbar werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass offenkundig rechtswidrige oder missbräuchliche Verwarnungen korrigiert werden. Eine solche Reform wäre ein wichtiger Schritt, um den Rechtsschutz im Bildungsbereich zu stärken, möglicher Willkür und Machtmissbrauch einen Riegel zu schieben und das Vertrauen in die Fairness des Systems zu erhalten und zu fördern.
Ein Kanton, welcher für sich in Anspruch nimmt, ein fairer und fortschrittlicher Arbeitgeber zu sein, muss diesem Anspruch auch in der Alltagsrealität gerecht werden, sonst verliert er an Glaubwürdigkeit. Und wenn die Schule als Institution eine gesellschaftliche Vorbildfunktion erfüllen soll, dann muss sie im Inneren die Grundsätze der Fairness, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung auch leben. Starre Hierarchien, welche die Mitarbeitenden zu blossen Befehlsempfängern und -empfängerinnen degradieren, haben in der modernen Arbeitswelt nichts verloren, schon gar nicht im öffentlichen Sektor.
Jürg Wiedemann
Vorstand Starke Schule beider Basel
09.05.2025
Zwei Frühfremdsprachen sind eine zu viel
Mit der Einführung der zweiten Frühfremdsprache in der Mittelstufe wurde das Fuder eindeutig überladen. Viele Kinder erleben nicht etwa ein erfrischendes «Sprachbad», sie gehen vielmehr im Chaos von drei und nicht selten bis zu fünf Sprachen (Muttersprachen zuhause) unter. Die von der EDK gestützte Mehrsprachendidaktik ist ein Kunstprodukt, mit dem eine Mehrheit der Mittelstufenschüler nichts anfangen kann. Wenn am Schluss eine so schöne Sprache wie das Französisch zum Hassfach wird, ist einiges krumm gelaufen.
Ein Mehrsprachenkonzept für die Primarschule war ursprünglich nicht vorgesehen. Frühenglisch als Weltsprache sollte auf Initiative des Zürcher Bildungsdirektors Ernst Buschor das Frühfranzösisch ablösen. Doch der Schuss ging weit daneben. Man hätte wissen müssen, dass das aus der Popkultur omnipräsente Englisch sofort das Französisch an den Rand drängen würde. Die meisten jüngeren Lehrpersonen entschieden sich, voll aufs Englisch zu setzen. Ausbildungsgänge in Englisch an den Pädagogischen Hochschulen waren gut belegt, während gleichzeitig das Interesse fürs Französisch rapid abnahm. Doch diese Neuorientierung beim Sprachenlernen kam in der Romandie gar nicht gut an. Um keine unnötige Zerreissprobe zu provozieren, entschied sich die EDK schliesslich für die unselige Mehrsprachendidaktik.
Der Widerstand gegen diese Verzettelung beim frühen Fremdsprachenlernen jedoch legte sich nicht. Eine frühe Fremdsprache ist genug, war die Leitidee bei mehreren kantonalen Volksinitiativen für ein neues Sprachenkonzept. Am Ende mischte sich auch noch die nationale Politik in die Diskussion ein. Pädagogische Überlegungen spielten kaum noch eine Rolle, dafür Symbolpolitik umso mehr. Bundesrat Alain Berset drohte den Ostschweizern, im Fall einer Abkehr von der Mehrsprachendidaktik sei das bei den Schülern und vielen Lehrpersonen bevorzugte Englisch zu streichen. Frühfranzösisch habe Priorität, hiess es aus Bern, ohne Rücksicht auf pädagogische Überlegungen. Es erstaunt des- halb nicht, dass danach alle kantonalen Spracheninitiativen abgelehnt wurden.
Ja, Alain Pichard hat recht, wenn er schreibt, dass mit dem schiefen Mehrsprachenkonzept das Französisch ganz bös unter die Räder gekommen ist. Weiterfahren wie bisher und so tun, als funktioniere alles einigermassen, ist nicht länger akzeptabel. Die Pädagogik und weit weniger die Politik ist jetzt herausgefordert.
Hanspeter Amstutz
Ehemaliger Bildungsrat und Sekundarlehrer
06.05.2025
Schlaf erhöht die Konzentration bei Jugendlichen
Die Konzentrationsfähigkeit von Jugendlichen nimmt stetig ab. Der Verlust von Konzentration hängt mit der verbreiteten Nutzung der sozialen Medien und allgemein mit dem Handykonsum zusammen. Es gibt aber weitere Faktoren, die die Konzentration von Jugendlichen beeinträchtigen. Einer dieser Faktoren ist die durchschnittliche Schlafdauer, die ein Jugendlicher pro Nacht bekommt.
Eine Studie, welche die Cambridge Universität und die Universität Fudan in Shanghai gemeinsam durchgeführt haben, zeigt auf, wie bereits wenige Minuten mehr Schlaf das Volumen des jugendlichen Hirns erheblich verbessern kann, berichtet der Guardian.
Die Studie, die auf der wissenschaftlichen Website «Cell Reports» veröffentlicht und zusammengefasst wurde, beinhaltete die Untersuchung von über 3'000 Jugendlichen. Die Ergebnisse der Forschung zeichnen ein klares Bild ab: Die Jugendlichen, die bei der Untersuchung am meisten geschlafen haben, weisen eine deutlich bessere Funktion des Gehirns auf.
Die Wissenschaftler:innen halten in ihren Studienresultaten jedoch fest, dass sich die Leistungsfähigkeit der Proband:innen durch die unterschiedliche Schlafdauer nicht bedeutend ändert, Allerdings zeigen Jugendliche, die mehr schlafen, bei den kognitiven Tests sehr gute Resultate. Diese guten Resultate lassen die Schlussfolgerung zu, dass das Volumen wie auch die Funktionsfähigkeit jener Jugendlichen, die mehr schlafen, besser ist.
Fazit
Die Studie schlussfolgert, dass viel Schlaf bei Jugendlichen massgeblich zu einer verbesserten Hirnleistung beiträgt und dies bereits bei einer Veränderung des Schlafes von weniger als einer halben Stunde.
Anahi Sidler
Sekretariat Starke Schule beider Basel
04.05.2025
Unsere Schulen: die verschwiegene Kehrseite der Inklusion
Solche Geschichte schaffen es selten in unsere Medien: Eine Reportage über eine Familie, in der das eine Kind hochbegabt, das andere sprachlich massiv minderbegabt ist. Von denen das minderbegabte in der Schule massive Förderung erhält, das hochbegabte fast zugrunde geht, weil die Pädagogen ausser Unverständnis und Überforderung so gut wie nichts anzubieten haben. Eine schreiende Ungleichheitsbehandlung! Und jetzt raten Sie einmal, für wen die neue Initiative «Schule für alle» noch mehr fordert: Für genau diese Schule!
«Schule für alle»? Wer könnte dagegen sein!
- Das Problem liegt nur darin, dass die herrschende, vor allem an den Pädagogischen Hochschulen gelehrte Ideologie behauptet, Schule für alle könne «integrative Schule für alle» bedeuten.
- Eine Schule, die alle Kinder, hoch- und minderbegabte, solche mit körperlichen und psychischen Behinderungen aller Art, Fremd- und Muttersprachliche unbedingt in ein einziges Klassenzimmer sperren will – wenn notwendig umschwirrt von einem Team an Pädagogen, Therapeuten und Sozialarbeitern. Alles andere, behaupten sie, sei menschenrechtswidrig.
Die Inklusions-Fanatiker schlagen zurück
Diese Ideologie hat in den letzten zwanzig Jahren in der Praxis weitgehend Schiffbruch erlitten und nun auch politischen Widerstand geweckt: Im Kanton Zürich ist vom Parlament bereits eine «Förderklasseninitiative» angenommen worden, die für Kinder, die den Betrieb einer Regelklasse nachhaltig behindern, wieder Kleinklassen erlaubt. In anderen Kantonen sind, nachdem die von der Schulpraxis unmittelbar Betroffenen – Lehrerinnen, Eltern, lokale Behörden – allzu lange geschwiegen haben, ähnliche Bestrebungen im Gange.
Dagegen bläst nun eine von Behindertenverbänden und linken Anhängern der integrativen Schule lancierte Volksinitiative zum Sturm. Nein, die integrative Schule sei nicht gescheitert, lautet die Argumentation. Es fehlten nur die nötigen organisatorischen Vorkehrungen und finanziellen Mittel, damit die Inklusion Erfolg habe. Dabei wurden bisher die Misserfolge der Übung immer wieder tunlichst unter den Teppich gekehrt.
Sonderschüler? In privaten Institutionen
Die Initianten übersehen, dass die beträchtlichen Mittel, die in der Vergangenheit in die schulische Integration gepumpt wurden, weder die pädagogischen noch die organisatorischen Ziele je erreicht haben.
-
So zeigen bisher unbekannte, in der «NZZ» nun publizierte Daten, dass in manchen Gemeinden immer mehr Schüler einen Sonderschulstatus erhalten, um das schöne pädagogische Bild der geglückten integrativen Schule aufrechtzuerhalten.
Weil aber das Potemkische Dorf der schulischen Integration zu wenig Plätze für Sonderschulen aller Art bereit hält, schicken die Gemeinden solche Schüler in private Institutionen, die erstaunlicherweise auch noch günstiger sind als die staatlichen Sonderschulen.
Wo Integration versagt
Und auch das ist nur ein Teil der Wahrheit über den angeblichen Erfolg der schulischen Integration. Die düsterste Seite der Integrations-Ideologie ist, dass sie bei einem Teil der Schüler versagt. Und zwar ausgerechnet bei den Hochbegabten. Darüber wird selten berichtet und, wenn überhaupt, nur halblaut hinter vorgehaltener Hand.
Und trotzdem sind ausgerechnet besonders Begabte Opfer der integrativen «Schule für alle», um die sich kaum jemand kümmert.
Umso verdienstvoller die grosse Reportage über zwei höchst gegensätzlich begabte Kinder aus ein- und derselben Familie, die – Kompliment! – in den CH-Medien erschien: Der zwei Jahre Ältere hochbegabt mit einem IQ von über 150, was sich erst herausstellte, nachdem sich die Lehrerin wegen seiner totalen Passivität bei den Eltern beschwerte – und völlig überfordert war, nachdem sie erfahren hatte, was der Erstklässler alles wusste. Doch die wenigen Massnahmen, die dem Buben zugutekamen, waren völlig ungenügend – etwas «Förderunterricht» und Überspringen von Klassen, voilà. Es war eine Qual!
Hochbegabung als Tragödie
Ganz anders bei der jüngeren Schwester:
- «Als sie drei Jahre alt war, stellten Pädiater eine Spracherwerbsverzögerung fest. Mit der Diagnose begann ein engmaschiges Fördernetzwerk zu greifen. Man bemühte die Logopädie. Dabei zeigte sich: Das Mädchen braucht sprachlich eine gezielte Förderung. Dafür kam es in den Kindergarten einer Sprachheilschule», lesen wir im St.Galler Tagblatt.
- Und das war nur der Anfang: «Bei T. war hingegen klar, welche Hilfestellungen sie benötigte. Die Eltern mussten sich nie darum kümmern. Stets waren Fachpersonen da, die sie unterstützten.
- «Die Massnahmen flogen uns nur so zu», sagt die Mutter. Die Invalidenversicherung übernahm die Kosten für die Logopädie. Und da die Sprachheilschule in einer anderen Gemeinde war, fuhr ein Sammeltaxi die Kindergärtlerin respektive Primarschülerin hin und her.
- «Es gab ein grosses Angebot für sie. Zudem wussten ihre Lehrpersonen genau, wie sie T. einzuordnen hatten – all das, was uns bei David fehlte», berichtet die Mutter.
Hochbegabung als Geschenk? Nicht in der Schweiz: «Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: Ich wünsche das niemandem. Ich empfinde es als Tragödie», bilanziert die Mutter.
Der Schweizer Gleichheits-Wahn
Was den beiden Kindern dieser Familie widerfuhr, ist kein Einzel-, sondern eher der Regelfall. Würde in unseren Pädagogischen Hochschulen wirklich Verständnis für das ganze Spektrum der Begabungen gelehrt und keine Ideologie, müsste Hochbegabung schon längst eine Priorität sein. Davon ist nach wie vor nicht die Rede.
Was für ein Widerspruch: Während man in den (ex-)kommunistischen Staaten im Osten Europas Hochbegabungen förderte, in den MINT-Fächern so gut wie in den musischen, leistet sich die kapitalistische Schweiz eine Gleichheits-Ideologie, die an zu kurz geratenen Pflänzchen mit aller Kraft zieht, die allzu hoch gewachsenen aber mit dem Rasenmäher kurz hält.
Gottlieb F. Höpli
Publizist, im Nebelspalter
[Quelle: Nebelspalter vom 02.05.2025]
29.04.2025
Lehrpersonen befürworten mehr Noten auf der Primarstufe
Aufgrund eines politischen Vorstosses zum Thema Noten auf der Primarstufe, der nach den Ferien im Landrat eingereicht wird, hat die Starke Schule beider Basel (SSbB) eine Umfrage gestartet, die im Vorfeld der Einreichung des Vorstosses ein Stimmungsbild bei Lehrpersonen, Eltern und Bildungsinteressierten einfangen soll.
Konkret stellt sich die Frage, ob an den Baselbieter Primarschulen nicht nur in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft) Noten erteilt werden sollen, sondern zusätzlich in weiteren Fächern. Bislang erhalten die Schulkinder in diesen drei Fächern Noten und in den anderen Fächern die folgenden Prädikate: «Grundanforderungen nicht erfüll», «Grundanforderungen erfüllt», «Erweiterte Anforderungen erfüllt», «Hohe Anforderungen erfüllt».
Mehrheit ist für Noten in mehr Schulfächern
Die Resultate der durchgeführten Umfrage, bei welcher 786 Personen aus den beiden Basler Halbkantonen teilgenommen haben (davon rund 84.5% Lehrpersonen), sind bemerkenswert: 55.8% der Umfrageteilnehmenden spricht sich für Noten in weiteren Fächern aus, 36.3% sind dagegen. (siehe Grafik 1)
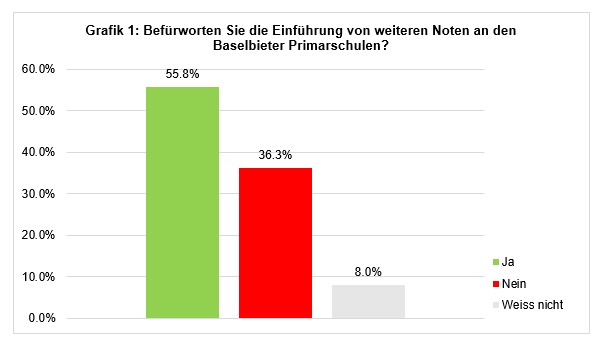
Die Umfrageteilnehmenden, welche in der ersten Frage die Einführung von weiteren Noten befürworteten, hatten in einer Folgefrage die Möglichkeit anzugeben, ab welcher Stufe die Schulkinder die zusätzlichen Noten erhalten sollten. (siehe Grafik 2)
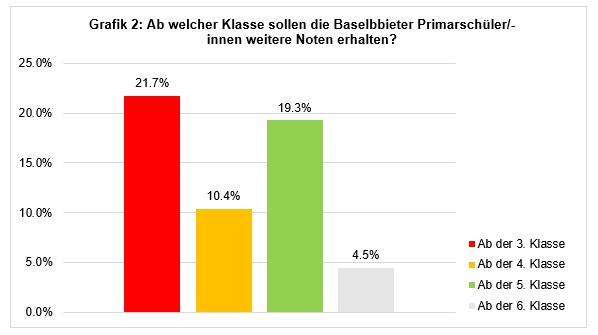
Die dritte Grafik bildet ab, in welchen weiteren Fächern Noten eingeführt werden sollen: Rund 80% der Umfrageteilnehmenden befürwortet Noten in Englisch und Französisch. Die weiteren Fächer erhielten Zustimmungswerte zwischen 45% und 56%, wobei Turnen und Sport diese Gruppe von Fächern anführt.
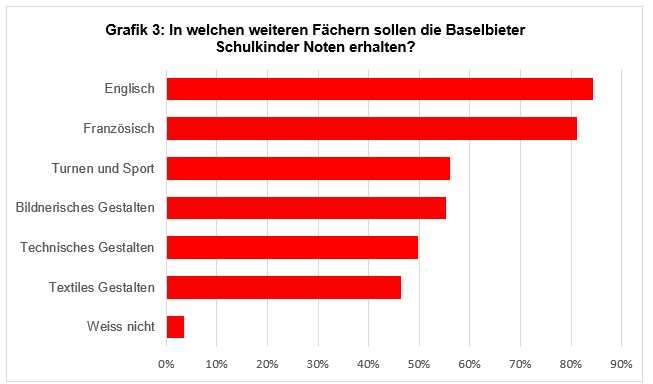
Zusätzliche Noten sollen auch für die Beförderung in die nächste Klasse und den Übertritt in die Sekundarschule zählen
Die Umfrage stellte folglich die Frage, ob für die Beförderung in die nächste Klasse die zusätzlichen Noten auch zählen sollten oder ob für die Beförderung weiterhin nur die Noten in Deutsch, Mathematik und NMG entscheidend sein sollen. Auch hier sind die Resultate deutlich: 53.7% befürworten, dass weitere Noten für die Beförderung zählen sollten, 35,6% sind dagegen,10.7% sind sich bei dieser Frage unsicher. (siehe Grafik 4)
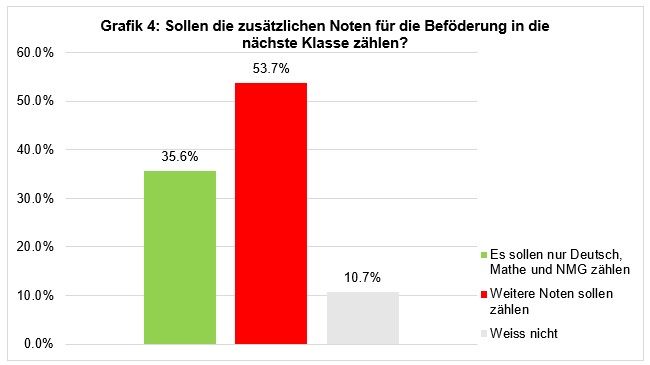
Dieselbe Frage konnten die Umfrageteilnehmenden in Bezug auf den Übertritt in die Sekundarschule beantworten. Dort fallen die Ergebnisse mit 62.8% Zustimmung sogar noch deutlicher aus. (siehe Grafik 5)
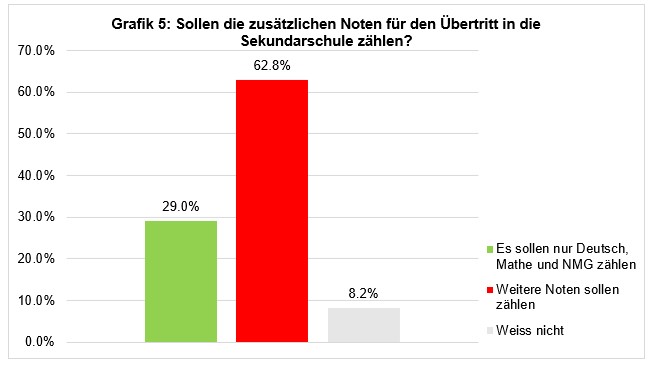
Vor- und Nachteile der Einführung von Noten in weiteren Fächern
Mithilfe eines Prosatextes bekamen die Befragten die Möglichkeit, Vor- und Nachteile der Einführung von Noten in weiteren Fächern kundzugeben. Insgesamt haben mit 373 Personen erstaunlich viele davon Gebrauch gemacht.
Bei den Vorteilen wurde ein Argument sehr häufig genannt: Die Schulkinder bekämen durch Noten ein umfassenderes Bild davon, was ihre effektive Leistung sei. Ebenfalls oft erwähnt wurde, dass die Schüler*innen durch das Einführen von mehr Noten bereits auf den Schulalltag in der Sekundarschule vorbereitet würden. Zudem würde dies ihnen ermöglichen, Schwächen und Stärken besser auszugleichen.
Bei den Nachteilen gab es ein ausschlaggebendes Argument, das oft notiert wurde: Die Schulkinder würden erhöhtem Leistungsdruck und mehr Stress ausgesetzt.
Kritische Bemerkungen zur Umfrage
Mehrere Umfrageteilnehmenden kritisierten, dass es in der Umfrage keine Möglichkeit gab, sich explizit gegen jegliche Noten auszusprechen, also auch um die Abschaffung der Noten in den drei Kernfächern Deutsch, Mathematik und NMG.
Die Frage, ob sämtliche Noten an den Primarschulen abgeschafft werden sollen, konnten die Umfrageteilnehmenden in einer kürzlich durchgeführten Umfrage der SSbB beantworten, wobei sich nur 18.4% der Umfrageteilnehmenden für keine Noten an den Primarschulen aussprachen. 81.6% befürworteten Noten an den Primarschulen.
Deshalb zielte diese Folgeumfrage ausschliesslich darauf ab, ob an den Primarschulen Noten in weiteren Fächern eingeführt werden sollen oder nicht.
Fazit
Die Ergebnisse der Umfrage sind deutlich: Eine Mehrheit ist dafür, dass an den Primarschulen in mehr Fächern Noten erteilt werden und diese auch für die Beförderung in die nächste Klasse sowie für den Übertritt in die Sekundarschule zählen sollen. Ein beachtlich grosser Teil der Umfrageteilnehmenden ist dafür, dass in den Fremdsprachen Fächern Englisch und Französisch Noten eingeführt werden.
Die Position im Vorstand und im Sekretariatsteam der Starken Schule beider Basel ist in dieser Frage unterschiedlich.
Anahi Sidler
Sekretariat Starke Schule beider Basel
24.04.2025
Frauen überholen Männer bei Tertiärabschlüssen in der Schweiz
Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat kürzlich Szenarien für das Bildungsniveau der Bevölkerung veröffentlich. Darin wird unter anderem ersichtlich, dass in rund 10 Jahren mehr 25- bis 64-jährige Schweizerinnen einen Tertiärabschluss besitzen als Schweizer.
Ein Tertiärabschluss ist ein Abschluss an einer Hochschule oder in der höheren Berufsbildung. Diese umfassen insbesondere den Eidgenössischen Fachausweis, das Eidgenössische Diplom, ein Diplom einer Höheren Fachschule sowie Abschlüsse von Universitäten und Fachhochschulen.
Die folgende Tabelle zeigt den Anstieg der Tertiärabschlüsse.
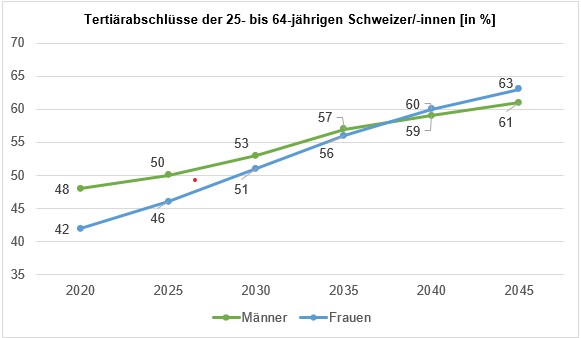
Bereits heute verzeichnen die Sekundarschulen im Niveau P mehr Mädchen als Knaben. Auch an den Gymnasien wächst die Abschlussquote von Frauen zunehmend.
Lange Zeit waren die Geschlechterrollen auch in Bildungsangelegenheiten klar; der Mann durfte eine hochrangige Ausbildung geniessen, während die Bildung für Frauen nicht verfügbar oder keine Priorität war. Dieser Bildungsrückstand wirkt sich bis heute auf diese Zahlen aus. Deswegen ist trotz der teilweise höheren Tertiärabschlussquote von Frauen die Gesamtzahl von allen 25- bis 64-jährigen Schweizerinnen heute noch tiefer als die der Schweizer. Laut BFS hält dies noch 10 Jahre an, bis die Frauen im Jahr 2036 erstmals mit den Männern gleichziehen, was die Tertiärbildung anbelangt. Ab 2038 überholen die Frauen die Männer erstmalig.
Diese Entwicklung ist erfreulich und ein wichtiger Beitrag, dass Frauen künftig gleichberechtigt auch wichtige und verantwortungsvolle Führungsaufgaben in der Berufswelt übernehmen können. Trotzdem gilt aufzupassen, dass sich nicht erneut ein Ungleichgewicht zuungunsten der Männer entsteht. Deswegen stellt sich die Frage, ob das heutige Bildungssystem und die Unterrichtsphilosophie für Schülerinnen besser geeignet und zielführender ist als für die Jungs im selben Alter. Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) äussert sich auf Anfrage der Starken Schule beider Basel (SSbB) dazu wie folgt.
Auf Anfrage der Starken Schule beider Basel, teilt uns Fabienne Romanens, Mediensprecherin der Bildungsdirektorin mit, dass der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) keine Daten zu den Ursachen vorliegen, weshalb Frauen die Männer bei den Tertiärabschlüssen überholen.
Lena Bubendorf
Vorstand Starke Schule beider Basel
23.04.25
Unverzichtbare Förderklassen ergänzen das Schulsystem
Ein Thema sorgte in der letzten Woche für einige Aufregung. Es ging um die Recherchen der NZZ über den enormen Anstieg von Schülern mit Sonderschulstatus und verdeckte Schülerzuweisungen in grosser Zahl in private Sonderschulen.
Explosionsartige Zunahme von Schülern mit Sonderschulstatus
Der Autor des NZZ-Beitrags stellte fest, dass sich die Anzahl der Sonderschüler in der Volksschule in den letzten zwanzig Jahren verdreifacht hat. Ein Teil dieser 9000 Kinder und Jugendlichen mit Sonderschulstatus wird im Rahmen des aktuellen Integrationsmodells weiterhin in den Regelklassen unterrichtet. Der Status «Sonderschüler» ermöglicht es auf einfachere Weise, Teildispensationen in einzelnen Fächern auszusprechen. Überforderte Schüler können so beispielsweise vom Französisch oder von Diktaten dispensiert werden. Aufhorchen lässt auch der zweite Teil des Berichts, in welchem es um nicht veröffentlichte Einweisungen von Schülern in private Sonderschulen geht. Jahrelang hat die Zürcher Bildungsdirektion unterschlagen, dass die Gesamtzahl der in teuren Sonderschulheimen unterrichteten Schüler um einen Fünftel grösser ist als allgemein bekannt war.
Die Kosten für die Sonderschulungen laufen aus dem Ruder
Bei den Budgets vieler Gemeinden fällt vermehrt auf, dass die Kosten für die Sonderschulungen enorm zu Buche schlagen. Tatsächlich ist es so, dass eine Heimeinweisung eines Schülers eine Gemeinde mit rund 55 000 Franken (ohne Kantonsbeitrag) pro Jahr belastet. Im Schulbudget sind diese Kosten nicht enthalten, da sie unter den Sozialkosten der Gemeinde verbucht werden. An der grossen kommunalen Gesamtbelastung für die Sonderschulung ändert sich aber nichts. Weil die Sonderschulheime heute chronisch überlastet sind, drängt sich eine Suche nach Alternativlösungen geradezu auf. Einige Gemeinden haben deshalb einen Teil ihrer Sonderschüler in kostengünstigeren privaten Institutionen platziert. Der Bericht in der NZZ zeigt, dass dieses Vorgehen mehrere sehr heikle Fragen aufwirft.
Überzogene Individualisierung und masslose Ansprüche fördern die Krise
Ein bis sechs Schüler pro Klasse würden sich während einer Unterrichtslektion öfters auffällig oder störend verhalten, war kürzlich im ZO zu lesen. Sie müssten eigentlich zeitweise 1:1 betreut werden, damit sie wieder in richtige Bahnen gelenkt werden können. Diese Aussage machte die Präsidentin des Zürcher Lehrerverbands im Rahmen eines Interviews über die Einführung von Förderklassen. Die grosse Zahl von Schülern mit intensivem Betreuungsaufwand macht stutzig. Was ist nur mit unserer Volksschule los, dass konzentriertes Lernen in manchen Klassen so schwierig geworden ist? Sicher stark ins Gewicht fällt, dass die unrealistischen Erwartungen ans individualisierte Lernen gewaltig gestiegen sind. Vorherrschende Theorien an den Pädagogischen Hochschulen legen Lehrpersonen nahe, massgeschneiderte Bildungswege für jedes einzelne Kind zu finden und individuelle Bildungsziele festzulegen. Dieses Lernkonzept hört sich zwar vielversprechend an, vermindert aber die Anpassungsleistungen der einzelnen Schüler an stabilisierende gemeinsame Normen im Klassenunterricht. Manche Kinder werden fordernder und ungeduldiger. Nicht geeignet für die Führung quirliger Klassen ist dabei auch ein als fortschrittlich geltendes Rollenbild, das Lehrkräfte als zurückhaltende Lernbegleiter und erst in zweiter Linie als Führungspersonen sieht.
Förderklassen im eigenen Schulhaus reduzieren Sonderschulungen
Die dringend notwendigen Förderklassen sind nicht dazu vorgesehen, den Grossteil der teils hausgemachten Schwierigkeiten unserer Volksschule aufzufangen. Diese sind ohne falsche Rücksichtnahme klar zu benennen und nicht länger zu verdrängen. Der überladene Lehrplan, das belastende Frühsprachenkonzept und ein unsinnig hoher Anspruch auf massgeschneiderte Lernwege erschweren eine Konzentration auf ein übersichtliches Bildungs-Kernprogramm. All das sorgt für viel Hektik und Unruhe in den Klassen. Es gilt deshalb, parallel zur Einrichtung von Förderklassen bei den genannten Baustellen gründlich aufzuräumen.
Die meisten verhaltensauffälligen Schüler benötigen keine separative Förderung. Time-out-Lösungen mit Schulinseln können einiges abdecken. Doch es gibt leider die wirklich happigen Fälle mit einem erheblichen Störpotenzial. Solche Schüler können ganze Klassen durcheinanderbringen.Diese «Systemsprenger» benötigen eine intensive Betreuung in einer Kleinklasse durch eine Lehrperson mit anerkannten heilpädagogischen Fähigkeiten. Förderklassen im eigenen Schulhaus sind eine nötige Ergänzung in einem integrierenden Schulsystem. Sie verhindern, dass Regelklassen völlig aus dem Ruder laufen und nur noch durch teure externe Sonderschulungen stabilisiert werden können. Mit dem Ja des Kantonsrats zugunsten von Förderklassen sind die Weichen richtiggestellt worden.
Unbelehrbare Dozenten der Hochschule für Heilpädagogik wehren sich gegen Förderklassen
Die Anhänger der unbedingten Integration aller Schüler in die Regelklassen wehren sich vehement gegen die Einführung von Förderklassen. Es sind vor allem Dozenten aus der Hochschule für Heilpädagogik, die jede Separation von Kindern rigoros ablehnen. Sie wollen nicht eingestehen, dass die Belastungen für Lehrpersonen in manchen Klassen nicht mehr tolerierbar sind und nur durch eine «Renaissance der pädagogischen Vernunft» deutlich reduziert werden können. Förderklassen gehören zu diesem Paket der Erneuerung.
Hanspeter Amstutz
Ehemaliger Bildungsrat und Sekundarlehrer
22.04.2025
Vorstoss für sichere Schulwege in Basel-Stadt
Im Basler Grossrat hat Tonja Zürcher (BastA) eine Motion eingereicht, mit der Forderung die Sicherheit der Schulwege fortlaufend zu verbessern. Unter anderem soll das «Konfliktgrün» (Fussgänger und abbiegende Autos haben gleichzeitig grün) wegfallen.
Nach dem tragischen Unfall Ende Juni 2024, bei dem ein 11-jähriger Junge aufgrund eines Konfliktgrüns ums Leben kam, werden nun die Sicherheitsvorgaben verschärft. Die Grossrätin fordert in ihrer Motion «rasche und konkrete Massnahmen». Der Vorstoss wurde mit 51 zu 39 Stimmen deutlich angenommen. Gefordert werden umfassende Sicherheitsmassnahmen auf allen Schulwegen bis spätestens 2029.
Weiter werden in der Motion Tempo 30 Zonen, Begegnungszonen und autofreie Strassen verlangt. Auch die Anzahl der risikoreichen Kreuzungen mit dem sogenannten Konfliktgrün sollen reduziert oder sogar ganz abgeschafft werden. Für das Abschaffen des Konfliktgrüns spricht die Regierung jedoch eine explizite Warnung aus, da längere Wartezeiten zu einem potenziell höheren Risiko durch Rotlichtüberquerungen führen könnten. Als Alternative werden längere Grünphasen für Fussgänger*innen und weitere Anpassungen genannt wie Mittelinseln und Poller.
Um die Umsetzung zeitlich realisieren zu können, wurde die ursprüngliche Umsetzungsfrist von zwei auf vier Jahre erhöht.
Lavinia Beck
Sekretariat Starke Schule beider Basel
20.04.2025
Die Schulen stecken in der Digitalisierungsfalle
Der Lehrplan 21 schrieb es vor: ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) sollten ab 2015/2016 obligatorisch an den Primarschulen eingeführt werden. Die Kantonsparlamente verabschiedeten daraufhin Millionenbudgets für die Digitalisierung der Schule – wohl ahnend, dass dies der Institution Schule schadet.

 Inzwischen haben die Bildungsverwaltungen ihre ICT-Dampfer auf Kurs gebracht und während der Corona-Pandemie richtig Fahrt aufgenommen. Wenn der Kurs solcher Bildungsfrachter einmal festgelegt ist, lassen sie sich kaum mehr wenden. Vor ein paar Wochen kündigte die Berner Bildungsdirektion an, weitere 22 Millionen Franken in die Schulinformatik zu investieren: Ab der 3. Klasse soll jedes Kind ein eigenes Gerät erhalten, damit es nicht mehr mit einem Mitschüler teilen muss. Noch mehr Isolation, noch mehr Einzelbeschäftigung mit einem seelenlosen Gerät.
Inzwischen haben die Bildungsverwaltungen ihre ICT-Dampfer auf Kurs gebracht und während der Corona-Pandemie richtig Fahrt aufgenommen. Wenn der Kurs solcher Bildungsfrachter einmal festgelegt ist, lassen sie sich kaum mehr wenden. Vor ein paar Wochen kündigte die Berner Bildungsdirektion an, weitere 22 Millionen Franken in die Schulinformatik zu investieren: Ab der 3. Klasse soll jedes Kind ein eigenes Gerät erhalten, damit es nicht mehr mit einem Mitschüler teilen muss. Noch mehr Isolation, noch mehr Einzelbeschäftigung mit einem seelenlosen Gerät.
Es geht längst nicht mehr darum, Lehrern den Alltag zu erleichtern, indem man das alte Lehrerbuch durch einen Computer ersetzt oder die klassische Rundtelefonliste durch einen Schul-Messenger. Nein, auch die Schüler müssen auf Kurs gebracht werden: Sie sollen Rechnungsaufgaben auf Tablets lösen, ihre Turnübungen filmen und die Dateien dem Lehrer übermitteln – anstatt sie in der Turnstunde vorzuführen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, wird in den behördlichen Strategiepapieren zur Digitalisierung der Volksschule nicht erörtert. Man will ja zur «Schule der Zukunft» gehören.
Tragweite nicht erkannt
Die Lehrer-Schüler-Beziehung bleibt die unverzichtbare Grundlage für gute Zukunftsperspektiven der Schülerinnen und Schüler. Doch genau diese Bildungssäule wird durch die Digitalisierung untergraben. In Ländern wie Schweden oder Dänemark, die diesen papierlosen Kurs eingeschlagen haben, ist deshalb eine Kurskorrektur eingeleitet worden.
In der Schweiz ist aber die Tragweite der Digitalisierungs-Euphorie – die Entfremdung zwischen Lehrern und Schülern, der Abbau familiärer Beziehungen mit schwerwiegenden Folgen für die Sprachkompetenz – vielen noch gar nicht bewusst. Stattdessen fordert man lediglich ein Verbot von TikTok oder eine Reduzierung der Handynutzung, während die Kinder im Unterricht vor noch grössere Bildschirme gesetzt werden.
Dabei ist unter Pädagogen unbestritten: Ein Primarschüler lernt nachhaltiger, wenn er mit dem Revierförster über den Feldhasen spricht und seinen Vortrag handschriftlich vorbereitet, als wenn er eine Internetrecherche per Copy-Paste zusammenstellt und mit PowerPoint präsentiert.
Unwohlsein vieler Lehrer
Wohl ist es vielen Primarlehrerinnen und Primarlehrern nicht. Sie versichern in den Medien, für einen «vernünftigen Umgang» mit ICT zu sorgen, während sie von Lehrmittelverlagen und Verwaltungen dazu gedrängt werden, die Kinder mit digitalen Aufgaben zu versorgen – aus teuren Lehrmitteln, an denen die Verlage sich satt verdienen.

An eine Kurskorrektur ist derzeit kaum zu denken. Statt einer ausgewogenen Digitalisierung treibt man die Schulen weiter in die Abhängigkeit von digitalen Systemen und ihrer Lehrmittelverlage. Wäre es nicht sinnvoller, den Fokus der Primarschule auf grundlegende Fähigkeiten wie Handschrift, Sprache und persönliche Interaktion zu legen? Statt Kinder frühzeitig an Bildschirme zu binden, sollten wir ihnen im jungen Alter die Möglichkeit geben, im zwischenmenschlichen Austausch zu lernen.
Berufsvorbereitung
Natürlich müssen Schüler auf die digitale Berufswelt vorbereitet werden – doch das muss nicht in der Primarschule geschehen. Die Sekundarstufe wäre der richtige Ort, um gezielt digitale Kompetenzen zu vermitteln, wenn Schüler alt genug sind, Technik reflektiert einzusetzen. Anstatt Erstklässler ans Tippen zu gewöhnen, sollten wir ihnen Zeit geben, grundlegende Kulturtechniken zu festigen. Andere Länder haben längst erkannt, dass eine unkritische Digitalisierung die Bildungsqualität gefährden kann. In Schweden beispielsweise wird wieder stärker auf gedruckte Lehrmittel gesetzt, um die Lesekompetenz zu verbessern. Wir sollten eine ernsthafte Debatte führen, bevor wir weiter in eine technisierte Schulwelt steuern, die mehr Kosten als Nutzen bringt.
Das Lehrernetzwerk Schweiz unterstützt darum Digitalisierungs-Stopp-Initiativen, wie sie im Kanton Luzern für kommenden Herbst angedacht sind. In unserem Positionspapier sprechen wir uns für einen behutsamen und massvollen Umgang mit der Digitalisierung mit Fokus auf die Berufswelt aus.
Daniel Wahl
Journalist, Lehrnetzwerk Schweiz
15.04.202
Petition: Verdoppelung der Studiengebühren stoppen
Die geplanten Sparmassnahmen des Bundes treffen die Studierenden hart. Sie führen zu massiven Budgetkürzungen im Bildungsbereich und einer drastischen Erhöhung der Studiengebühren.
Wenn diese umgesetzt werden, werden die Studiengebühren an Universitäten und Hochschulen in der Schweiz verdoppelt – für Studierende aus dem Ausland sogar vervierfacht. Diese Massnahmen gefährden den Zugang zu den Hochschulen und sind ein direkter Angriff auf Chancengleichheit und die Zukunft der Schweiz.
Deshalb fordert der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) mit einer Petition: Stoppt die Verdoppelung der Schweizer Studiengebühren und wahrt die Chancengleichheit!
Als nationale Dachorganisation der Studierendenschaften setzt sich der VSS für ein faires, öffentlich finanziertes Hochschulsystem ein. Er vertritt die Interessen von rund 140’000 Studierenden und kämpft für einen gerechten Zugang zur Bildung.
Warum müssen wir jetzt handeln?
- Bedrohung der Chancengleichheit: Höhere Studiengebühren schliessen Studierende mit geringem Einkommen aus, unabhängig von ihren akademischen Fähigkeiten.
- Risiken für Innovation und Wirtschaft: Die Budgetkürzungen gefährden die Position der Schweiz als Bildungs- und Forschungsexperte, was die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigt.
- Verschlechterung der Qualität von Lehre und Forschung: Ohne ausreichende Finanzierung leidet die Qualität der Lehre und Forschung, was die Wettbewerbsfähigkeit schwächt.
- Längere und teurere Studien: Studierende müssen mehr arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren, was ihren akademischen Weg verlängert und ihre berufliche Eingliederung verzögert.
Unterzeichnen Sie die Petition. Den Unterschriftenbogen können Sie hier unterzeichnen.
Teile sie mit deinem Umfeld und lass uns gemeinsam gegen diese ungerechten Erhöhungen kämpfen und ein gerechtes und qualitativ hochwertiges Bildungssystem bewahren.
Orlane Brechbühl
Hochschulpraktikantin
| Die Starke Schule beider Basel empfiehlt die Petition zu unterschreiben. |
11.04.2025
Gesetzeslücke in Baselland
Im Kanton Basel-Landschaft können Schulleiter/-innen Mitarbeitende mit vagen Verwarnungen unter Druck setzen, ohne dass Betroffene rechtlich dagegen vorgehen können. Ein fragwürdiges Gesetz schafft ein Machtungleichgewicht, das Grundrechte infrage stellt. Brisant: Von vielen überprüften Kantonen ist Baselland der einzige Kanton mit einem entsprechenden Paragraphen, welcher die Anfechtbarkeit von Verwarnungen explizit verbietet.
Baselland hat ein willkürliches System
Das Personalgesetz Basel-Landschaft erlaubt es Vorgesetzten, Mitarbeitende im Rahmen sogenannter nicht-disziplinarischer Führungsmassnamhen zu sanktionieren. Weil Verwarnungen keinen Verfügungscharakter haben, können sie rechtlich auch nicht angefochten werden (vgl. Personalverordnung 150.11, §15, Abs. 3). Angestellte, also auch Lehrpersonen im Dienste des Kantons, sind dem Verwarnungs-Regime ihrer Vorgesetzen völlig ausgeliefert.
Wenn nun ein Schulleiter oder eine Schulleiterin in der Verwarnung gegen eine Lehrperson unter den Zielvorgaben festhält, dass jene während der Probezeit «weniger Problemsituationen schaffen» oder in bestimmten Situationen «adäquater reagieren» soll, dann liegt es am Ende der Probezeit ausschliesslich im Ermessen des oder der Vorgesetzten darüber zu entscheiden, ob der oder die Verwarnte die Vorgaben erfüllt hat.
Vorgesetzte als Richter/-in in eigener Sache
Schulleitende werden im Rahmen eines solchen Systems zu Anklagenden, indem sie Mitarbeitende mit Vorwürfen belasten und gravierende Konsequenzen wie die Kündigung bei Nichterfüllung der von ihnen definierten Vorgaben androhen, und gleichzeitig sind sie die alleinigen Richter/-innen, die darüber entscheiden, ob der oder die Mitarbeitende die Probezeit am Ende «bestanden» hat.
Existenz auf dem Spiel
Dieses Willkür-Regime ist für einen Rechtsstaat besonders unwürdig, weil es für Betroffene existenzbedrohend sein kann. Es handelt sich um ein System, das Macht ohne Grenzen zulässt. Wenn verwarnten Angestellten schliesslich die Stelle gekündigt wird, was eben im alleinigen Ermessen ihrer Vorgesetzten liegt, dann verlieren sie ihre materielle Existenzgrundlage. Jurist/-innen sehen hier Verstösse gegen das allgemeine Rechtsstaatsprinzip (Bundesverfassung, Art. 5) Verstösse gegen den Schutz vor Willkür (Bundesverfassung, Art. 9) und gegen das Recht auf rechtliches Gehör und faires Verfahren (Bundesverfassung, Art. 29)
Signalwirkung
Nicht zu unterschätzen ist auch die Signalwirkung, welche die Nichtanfechtbarkeit von Verwarnungen unter Umständen bei gewissen Schulleiterinnen und Schulleitern entfaltet: Wenn Vorgesetzte wissen, dass gegen die von ihnen verhängten Disziplinarmassnahmen a priori keine Rechtsmittel eingelegt werden können, brauchen sie sich auch nicht sonderlich darum zu bemühen, faire, dem Verhältnismässigkeitsprinzip genügende und im Zweifelsfall rechtssichere Massnahmen zu ergreifen.
Fazit
Der Kanton Basel-Landschaft sieht sich selbst gerne als fortschrittlicher Kanton und als vorbildlicher Arbeitgeber. Umso stossender ist es, dass im Baselbiet Vorgesetzte im öffentlichen Sektor ihre Mitarbeitenden nach Belieben verwarnen und mit Kündigung bedrohen können, ohne dass jene sich rechtlich dagegen zur Wehr setzen können. Es bedarf dringend einer Anpassung im Personalgesetz, damit die Grundrechte der Angestellten gewahrt bleiben und willkürliche Verwarnungen aufgehoben werden können.
Jürg Wiedemann
Vorstand Starke Schule beider Basel
___________________________________________________________________________
Ältere Artikel finden Sie im
Archiv.
24.06.2025
Vetternwirtschaft und autoritärer Führungsstil der Schulleitung lösen Flut von Kündigungen aus
14 teils langjährige und erfahrene Primarlehrpersonen haben ihr Arbeitsverhältnis an der Primarschule Allschwil auf Ende dieses Schuljahres gekündigt – dies teilte die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) auf Anfrage im Landrat mit. Hinzu kommen alle Lehrpersonen, die eine Verlängerung ihres auslaufenden Arbeitsvertrages ablehnten.
Die Vorwürfe an die Adresse der Schulleitung wiegen schwer: willkürliches, schikanöses und gesetzwidriges Verhalten, Mobbing, Vetternwirtschaft mit der Bevorzugung von Familienangehörigen eines Schulleitungsmitgliedes, sowie ein autoritärer, teils diktatorischer Führungsstil.
Primarlehrpersonen erhalten Maulkorb
Der Starken Schule beider Basel (SSbB) sind E-Mails, Briefe und verschiedene Dokumente von rund einem Dutzend Lehrerinnen und Lehrern zugestellt – mit brisantem Inhalt: Die Zustände an der Primarschule Allschwil seien laut mehreren Zuschriften desaströs. Die Schule werde von einem Rektor geführt, den eine langjährige Lehrperson gegenüber der SSbB als «narzisstisch» bezeichnete.
Seit einiger Zeit, so berichten Betroffene, sei eine freie Meinungsäusserung im Konvent kaum mehr möglich. Lehrpersonen, die es dennoch wagten, wurden vom Rektor zitiert und zurechtgewiesen. Vieles deutet darauf hin, dass den Primarlehrpersonen stillschweigend ein Maulkorb verpasst wurde – offenbar eine Überreaktion eines überforderten Schulleitungsmitglieds.
Der Rektor soll inzwischen aufgrund mentaler Probleme und physischer Überlastung seit Wochen krankgeschrieben sein. Nun ist er auf Tauchstation: Antworten auf Fragen der SSbB oder eine klärende Stellungnahme? Fehlanzeige. Wir hätten seine Darstellung gerne in diesem Artikel berücksichtigt.
Vetternwirtschaft – eine üble Sache
Es scheint kein Einzelfall zu sein: Schulleitungsmitglieder sollen bei Anstellungen und Stundenwünschen systematisch Familienangehörige, deren Freundinnen und Bekannte bevorzugen. Eine Lehrperson schreibt uns: «Die Tochter der Schulleiterin, obwohl diese erst seit Kurzem an unserer Schule, erhielt eine Unterstufenklasse» und darf ins gleiche Schulhaus wechseln, jenes Schulhaus, das von ihrer Mutter geleitet wird.
Eine andere Lehrperson bringt es pointiert auf den Punkt: «Eine derartige Bevorzugung von Familie und Freunden ist aus meiner Sicht in einem fairen und transparenten Schulsystem nicht vertretbar.»
Demgegenüber würden Wünsche von langjährigen und erfahrenen Lehrpersonen, die sich auch mal kritisch äussern, von der Schulleitung ignoriert oder sie würden sogar als Strafmassnahme aus ihren gut funktionierenden Teams herausgerissen, in ein anderes Schulhaus zwangsversetzt und das Ganze als Führungsmassnahme deklariert.
Ein Klima der Angst und Verunsicherung
Eine Primarlehrperson beschreibt uns die Situation wie folgt: «An der Primarschule Allschwil herrscht, aufgrund der Handlungen der Schulleitung, ein Klima voller Angst und Verunsicherung. Dieser belastende Zustand besteht nun seit fast zwei Jahren und verschärft sich zusehends». Zugespitzt habe sich die Situation, «nachdem sich das Kollegium für eine Kollegin starkgemacht hat, die ein Jahr lang vom Rektor (…) einen unbefristeten Vertrag versprochen bekam, diesen aber nicht erhalten hat». Solche «wiederholten Versprechen seitens der Schulleitung, die nicht eingehalten wurden», würden dem «Schulklima schaden».
Eine andere Lehrperson beschreibt den Führungsstil des Rektors folgendermassen: «Seit einigen Jahren beobachte ich mit wachsendem Unbehagen zwei Entwicklungen, die das Arbeitsklima an unserer Schule massiv beeinträchtigen: eine autoritäre, fast schon diktatorische Führungsweise sowie eine ausgeprägte Vetternwirtschaft.» Sie erlebe den Rektor als «empathielos».
Wird kantonales Recht missachtet? Streit um Entlastungslektionen.
Seit dem Schuljahr 2023/24 erhalten Klassenlehrpersonen der Primarstufe eine Jahreslektion zur Entlastung für administrative Aufgaben im Rahmen ihrer Klassenführung. Der Umgang mit dieser Entlastungslektion ist im kantonalen «Merkblatt Entlastungslektion Klassenlehrpersonen Primarstufe» durch das Amt für Volksschulen (AVS) geregelt. Insbesondere bei Teilpensen und geteilten Klassenlehrfunktionen im Jobsharing hält das Merkblatt unmissverständlich fest: «Eine Auszahlung der Entlastungslektion ist nicht möglich». (siehe folgende Darstellung aus dem Merkblatt)
Nicht so in Allschwil: Lehrpersonen mussten sich laut mehreren E-Mails diese Entlastungsstunden auszahlen lassen – entgegen den unmissverständlichen Vorgaben des kantonalen Merkblatts. Eine Gutschrift in der Stundenbuchhaltung wurde ihnen verweigert.. Warum die Schulleitung diese klare Weisung des AVS ignoriert, bleibt offen. Eine entsprechende Anfrage der SSbB bei der Schulleitung blieb unbeantwortet. Eine Schulleiterin verweigerte jede Auskunft und verwiess lapidar auf die Schulratspräsidentin.
Kettenverträge sind meist unzulässig – die rechtliche Situation
Für Lehrpersonen mit abgeschlossener Ausbildung gilt gemäss §5 der Personalverordnung: «Der Arbeitsvertrag ist in der Regel unbefristet abzuschliessen». Ausnahmen regelt §6 der Personalverordnung. Ein befristeter Arbeitsvertrag ist nur dann zulässig, wenn eine der folgenden drei Bedingungen erfüllt ist:
a. für Anstellungen, die aufgrund ihrer Aufgabenstellung befristet sind;
b. für den befristeten Einsatz in einer Stellvertretungsfunktion;
c. für Anstellungen von Lehrpersonen, wenn die Ausbildung unvollständig ist.
Ist keine dieser Ausnahmen gegeben, besteht ein Anspruch auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Zwei typische Beispiele für rechtlich zulässige Befristungen gemäss §6 der Personalverordnung sind: Wenn eine Klasse vorübergehend eröffnet und dafür eine zusätzliche Lehrperson benötigt wird (lit. a.) oder wenn es sich um eine Vertretung z.B. bei einem Mutterschaftsurlaub handelt (lit. b.).
Wenn keine Ausnahmeregel vorliegt, bedeutet das faktisch: Lehrpersonen mit abgeschlossener Ausbildung werden in der Regel unbefristet angestellt. Während der ersten sechs Monate gilt die gesetzlich vorgesehene Probezeit, in der das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten unter erleichterten Bedingungen gekündigt werden kann.
Für Lehrpersonen, die ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben, sind in §6 die Abs. 2 und 5 relevant: Absatz 2 legt fest, dass die Gesamtdauer aller befristeten Arbeitsverhältnisse in der Regel 48 Monate nicht überschreiten soll. Absatz 5 wird ergänzt, dass befristete Arbeitsverträge für dieselbe Funktion mit derselben Person in der Regel höchstens dreimal hintereinander abgeschlossen werden dürfen.
Für Lehrpersonen bedeutet das konkret: Da sie in der Regel keinen Funktionswechsel durchlaufen, ergibt sich faktisch eine maximale Befristungsdauer von 36 Monaten (drei aufeinanderfolgende Einjahresverträge in derselben Funktion).
Bei einem Funktionswechsel, was bei Lehrpersonen im Normalfall nicht vorkommt, wäre die 48-Monatsregel gemäss §6, Abs. 2 der Personalverordnung wirksam. Eine fortgesetzte Befristung ohne gesetzliche Grundlage ist daher rechtswidrig.
Missachtung von Personalgesetz und Personalverordnung
Zahlreiche Mails und Briefe belegen, dass sich der Rektor der Primarschule Allschwil wiederholt über die Vorgaben des Personalgesetzes und Personalverordnung hinwegsetzt. Gleichzeitig scheint die Schulratspräsidentin nicht in der Lage, die Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen durch die Schulleitung wirksam durchzusetzen. Nachfolgend ein exemplarischer Fall:
«Nachdem ich nun meinen fünften Arbeitsvertrag mit der Primarschule Allschwil erhalten soll und mir Herr (…) [genannt wird der Name des Rektors] mehrmals einen unbefristeten Vertrag zugesichert hat, war ich sehr irritiert und enttäuscht (…) zu erfahren, dass der Arbeitsvertrag wieder nur ein befristeter sein soll.» Nach einem klärenden Gespräch mit der Schulleitung, wurde der Lehrperson eröffnet, «dass sie möglicherweise gar keinen Vertrag mehr erhalten soll». Und dies, obwohl der Stundenplan bereits an die Eltern verschickt und das «zugesagte Pensum in SAL eingetragen» wurde und der Rektor der Lehrperson «ein Budget von Fr. 1´800.- zugesprochen» hat «für ein Projekt mit der neuen Klasse im neuen Jahr».
Die Drohung der Schulleitung, dieser Lehrperson keinen neuen Vertrag zu erteilen, stellt ein klares Zeichen mangelnder Führungskultur dar und eine grobe Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben.
Der eingeschaltete Lehrerinnen- und Lehrerverband Baselland (LVB) reagiert mit einer «Anzeige arbeits- und führungsrechtlicher Missstände in der Schulleitung der Primarstufe Allschwil» und weist auf «schwerwiegende Führungsmängel im Schulbetrieb Allschwil» hin, die «nicht nur individualrechtlich, sondern auch aufsichtsrechtlich und systematisch Relevanz entfaltet». Das vom LVB treffend und brillant verfasste Schreiben deckt die «widersprüchliche Personalführung, strukturelle Benachteiligung und systematische Verunsicherung» auf. Und weiter: «Der Führungsstil der Schulleitung Allschwil zeichnet sich gemäss mehreren Rückmeldungen durch hohen Druck, mangelnden Respekt gegenüber Mitarbeitenden und fehlender Gesprächskultur auf. In den letzten zwei Jahren haben zahlreiche engagierte und langjährige Mitarbeitende die Schule verlassen – ein Umstand, der nicht etwa zur Reflexion führte, sondern zur Verschärfung der Kontrolle und Ausgrenzung seitens der Führungsverantwortlichen.»
Das oben dargestellte Beispiel ist nur eines von vielen, das die fortgesetzte Missachtung des Personalgesetzes und der Personalverordnung dokumentiert.
Die Schulleitung bedient sich sogenannter Kettenverträge (= jährlich befristeter Arbeitsverhältnisse), die über mehrere Jahre hinweg fortgesetzt werden, ohne dass ein unbefristeter Vertrag ausgestellt wird. Auch wenn eine rechtliche Qualifikation als „Kettenvertrag“ erst im Einzelfall durch ein Gericht erfolgen würde, deutet die systematische Praxis auf ein strategisches Machtmittel hin: Lehrpersonen, die als kritisch gelten, erhalten schlicht keinen neuen Vertrag.
Ausweichmanöver statt Aufsicht - eine überforderte Schulratspräsidentin
Die SSbB hat die Schulratspräsidentin mit konkreten Fragen zur Personalkrise an der Primarschule Allschwil konfrontiert. Ihre Antwort offenbart eine klare Verweigerungshaltung: Anstatt auf die nachweislich dokumentierten Vorwürfe oder die 14 Kündigungen einzugehen, versteckt sie sich hinter formalen Floskeln. Mit Verweis auf Datenschutz und Amtsgeheimnis weicht sie sämtlichen substanziellen Fragen aus – obwohl eine grundsätzliche Stellungnahme zur Arbeitssituation ohne Offenlegung personenbezogener Daten problemlos möglich wäre.
Besonders bezeichnend ist ihre Rückfrage nach dem "Zusammenhang" der Anfrage der SSbB, obwohl dieser angesichts der zahlreichen Kündigungen und eingegangenen Beschwerden offensichtlich ist.
Die pauschale Delegation der Verantwortung an den Kanton wirkt wie ein Ablenkungsmanöver einer Amtsträgerin, die entweder nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, zu den schwerwiegenden Vorwürfen von Mobbing und der Rechtsverletzungen Stellung zu beziehen.
Fazit
Die dokumentierten Führungsschwächen in der Schulleitung offenbaren gravierende systemische Defizite, verschärft durch eine überforderte und wenig durchsetzungsfähige Schulaufsicht Wo Kontrollinstanzen versagen und destruktive Führungspraktiken toleriert oder gar gefördert werden, entsteht ein toxisches Arbeitsumfeld, das die Schulqualität gefährdet und Lehrpersonen, Schüler/-innen sowie Eltern – nachhaltig belastet.
Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwerwiegende und teils irreversible Schäden durch personelle Fehlbesetzungen in Leitungsfunktionen entstehen können. Eine funktionierende Schule braucht integre, kompetente und kooperationsfähige Führungspersönlichkeiten, die das Wohl der der Institution über Eigeninteresse stellen.
Angesichts der dokumentierten Missstände ist ein personeller Neuanfang unvermeidlich. Sowohl in der Schulleitung als auch im Schulrat müssen die verantwortlichen Personen zum Wohl der Schule ihre Ämter niederlegen und durch charakterlich geeignete, professionell ausgewiesene Personen ersetzt werden. Mit dem Ziel einer transparenten, respektvollen und konstruktiven Führungskultur. Nur so kann das beschädigte Vertrauen wiederhergestellt und eine positive Entwicklung der Primarschule Allschwil ermöglicht werden.
Jürg Wiedemann
Vorstand Starke Schule beider Basel