Das Eigenleben der Lehrerverbände
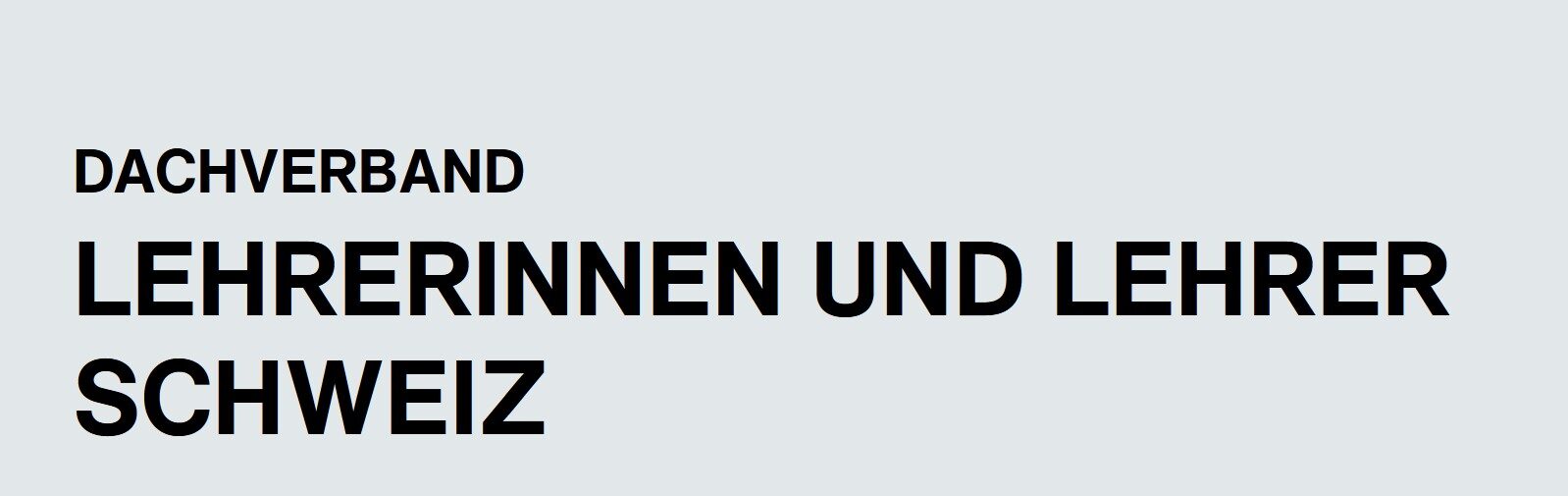
Die Lehrerverbände wissen angeblich, was für die Schule gut ist. Sie meckern über Referenten. Sie verteidigen die integrative Schule und lassen sich dann im Namen aller Lehrer vernehmen. Aber Basisbefragungen führen sie kaum durch und unerwünschte Resultate halten sie unter Verschluss. Was ist los?
Obwohl sich der Wind längst gedreht hat, verteidigen die Lehrerverbände das integrative Schulmodell durch alle Böden hindurch – während es viele Pädagogen und Politiker inzwischen als gescheitert betrachten. In Basel sind Förderklassen angestossen worden, weil Lehrer wieder «klar für Kleinklassen» sind, in Luzern verlangt die SP eine Prüfung des Systems. In Zürich fordert das Kantonsparlament mit 92 zu 76 Stimmen eine Rückkehr zu den Förderklassen. Regierungsrätin Silvia Steiner (Die Mitte) muss jetzt eine Gesetzesänderung oder konkrete Massnahmen vorschlagen – ein Entscheid mit Signalwirkung.
Umdenken setzt ein
Die Trendwende in den Kantonen zeigt zunächst: Die Kritik am integrativen Schulmodell, wie sie auch im Positionspapier des Lehrernetzwerkes Schweiz verankert ist, findet langsam Gehör, und die Folgen der integrativen Schule sind unübersehbar geworden.
Indessen ist auch die Einführung von zwei Fremdsprachenfächern an den Primarschulen unter Druck geraten. Obwohl im Lehrplan 21 verankert, hat nun der Appenzeller Kantonsrat den Regierungsrat beauftragt, Frühfranzösisch an den Primarschulen zu begraben. Der Erfolg sei zu bescheiden gewesen. Das gibt Raum, die unter die Räder gekommenen Fächer Deutsch und Mathematik zu stärken.
Nachteile für Regelschüler
Aber eine Gruppe steuert mit verlässlicher Sicherheit dagegen: die Lehrerverbände. Nachdem das Zürcher Parlament gegen das integrative Schulmodell abgestimmt hatte, fühlte sich Lena Fleisch, Präsidentin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands, zur Mitteilung berufen, dass «viele Kinder in den Regelklassen benachteiligt würden», sollten Förderklassen geschaffen werden. Die Nachteile des integrativen Schulmodells für die Regelschüler klammerte sie gekonnt aus. Ihr Auftritt im Schweizer Fernsehen vermittelte, dass die Lehrer generell am integrativen Schulmodell festhalten würden.
Derselbe Vorgang war auch im Kanton Nidwalden zu beobachten, als Bildungsdirektor Res Schmid in einem vielbeachteten Interview in der «NZZ» erklärte: «Die integrative Schule verliert ihren Sinn, wenn das Niveau und die Qualität der Regelklasse wegen der Integration sinken.» Diese Einschätzungen des Bildungsdirektors passten Tanja Murer, Co-Präsidentin des Nidwaldner Lehrerverbands und Barbara Ming, Präsidentin des Verbands der Schulleitungen Nidwaldens nicht. Sie kommentierten Res Schmids Aussagen «mit Befremden» und unterstellten ihm, er würde auf Kosten der Schüler ideologische Grabenkämpfe lancieren. Die Nidwaldner Zeitung titelte: «Lehrerschaft widerspricht Res Schmid.»
Geteilte Lehrerschaft
Die Lehrerschaft? Sicher nicht. Dem Lehrernetzwerk liegen zahlreiche Schreiben vor, in denen die Lehrer auf Distanz zu ihrem Verband gehen und ihrem Regierungsrat für die klaren Worte danken. Unter anderem schrieb ein Lehrer: «Was sich der LVN leistet, beziehungsweise durch dessen Exponenten verlauten lässt, ist wohl sehr gesucht und entspricht kaum der Meinung der Gesamtlehrerschaft Nidwaldens.» Ein Lehrer informierte Res Schmid, die Reaktion des Verbands sei ganz und gar nicht in seinem Sinne verfasst, auch nicht im Sinne seines Kollegiums – und wohl kaum im Sinne der gesamten Lehrerschaft, wie der Zeitungsbeitrag suggeriere. Er werde aus dem Verband austreten. Unbestritten ist, dass die integrative Schule eine der Hauptursachen dafür ist, dass das Bildungssystem an seine Grenzen geraten ist. Aber von den Lehrerverbänden wird dieses Thema konsequent ausgeklammert.
Wie selektiv die Verbände sind, ist schon fast bewundernswert. Beat A. Schwendimann, Leiter Pädagogik beim Lehrerdachverband LCH, legt eine Studie zum «Linksdrall» an den Aargauer Schulen nach seinem Gusto aus. Die Studie habe ergeben, dass eine Mehrheit sich an der Kantonsschule ideologisch nicht beeinflusst sehe, sagte er gegenüber dem Onlineportal «Nau». Die Mehrheit ist für Schwendimann ein Beleg dafür, dass kein Handlungsbedarf gegen ideologischen Unterricht bestehe. Was ist aber mit der beträchtlichen Minderheit, die sich doch ideologisch beeinflusst fühlt? Nebenbei kritisierte der Mann auch die Zusammensetzung der Referenten an der Mitgliederversammlung des Lehrernetzwerks Schweiz.
Nähe und Ideologie
Die «Starke Schule beider Basel» lanciert jährlich mehrere Umfragen, um den Puls der Lehrerschaft zu erkunden. Ihr Gründer, Jürg Wiedemann, gibt drei Gründe an, weshalb die Lehrerverbände ihren eigenen Kurs fahren: Die Präsidenten haben eine zu grosse Nähe zu den Bildungsverwaltungen, sie haben viele Fehlreformen unterstützt und verteidigen ihre Entscheidungen. Schliesslich ist die Verbandsmeinung in den seltensten Fällen demokratisch abgestützt. «Man führt keine Basisbefragungen durch», sagt Wiedemann.
Die einseitige Positionierung seines Verbands rüffelte auch ein Sekundarlehrer aus dem Oberaargau, Mitglied von Bildung Bern, auf dem Blog «condorcet.ch». Er habe im letzten Jahr an der LCH-Berufszufriedenheitsstudie teilgenommen. Als er die Auswertung las, habe er festgestellt, dass ein wesentlicher Teil der Befragungsthemen fehlte, nämlich der zur «Schulischen Selektion» – auf der Homepage des LCH kein Wort, auch in den Zeitungsartikeln war nichts darüber zu lesen. Von einem Insider habe er erfahren, dass die Ergebnisse vom LCH unter Verschluss gehalten wurden, weil deren Ergebnisse nicht gefallen haben.
Das Lehrernetzwerk Schweiz ist überzeugt: Nur Offenheit und gelebte Vielfalt bringen Bildung voran.
Daniel Wahl
Journalist, Lehrnetzwerk Schweiz
