25.12.2024
Die Lesemisere ist hausgemacht
Die Lese- und Schreibkompetenz in der Schweiz wird immer schlechter. Das zeigt die neue Pisa-Studie für Erwachsene (OECD-Studie, siehe hier). Offensichtlich ist die Ausbildung an den Schulen zu wenig nachhaltig. Die Pädagogischen Hochschulen der Schweiz müssen ihr Ausbildungskonzept der angehenden Lehrpersonen überdenken.
Nun ist offiziell, was Lehrerinnen und Lehrer an Berufsschulen seit einigen Jahren feststellen: Die Lese- und Schreibkompetenz der Schweizer Bevölkerung nimmt stark ab. Würde ich einer Klasse den Satz aus der OECD-Studie «Bringen Sie Ihr Kind bis 10 Uhr in den Kindergarten» diktieren, schafften es auch in den kognitiv stärksten Klassen (10–18 Personen) etwa zwei Lernende, den Satz fehlerfrei zu schreiben. Verstehen würden ihn je nach Lehre nicht alle. Auch ums Lesen steht es schlecht. Erstens drücken sich die Lernenden nach Kräften vor dem Lesen, weil es ihnen schwerfällt. Zweitens habe ich bei vielen Lernenden den Eindruck, dass sie kaum verstehen, was sie lesen.
Dabei handelt es sich keineswegs nur um Jugendliche, die eine lange Fluchtgeschichte hinter sich haben, oder um jene, die als zugewanderte Erwachsene eine Lehre machen. Unter ihnen sind einige, die gut Bescheid wissen über Grammatik, Rechtschreibung und das Satzzeichen Punkt. Andere können genug Deutsch, um den Alltag zu bestreiten. Gemeint sind hier nicht Zugewanderte. Es gibt Lernende, welche die Primar- und Sekundarschule in der Schweiz besucht haben und die Grundkompetenz in Lesen und Schreiben nicht beherrschen. Mit Grundkompetenz meine ich: Gross- und Kleinschreibung, den Punkt am Ende eines Satzes, einen vollständigen Satz mit Subjekt, korrekt konjugiertem Verb und korrekt dekliniertem Objekt.
Es fehlt das Bewusstsein für die Wichtigkeit von korrekter und damit verständlicher Sprache. Die Schüler realisieren ihr Handicap erst, wenn sie mit Google oder KI versuchen, eine Aufgabe zu lösen, aber diese Systeme ihr phonetisch geschriebenes Deutsch/Schweizerdeutsch nicht entziffern können. Später in der Berufslehre haben sie noch maximal drei Lektionen pro Woche, um an ihrer Sprachkompetenz zu arbeiten.
Natürlich lernen die Kinder in der Volksschule viele wichtige Dinge, wie Vorträge zu halten (was viele gut können), sie wissen theoretisch Bescheid über die Gefahren von sozialen Netzwerken, und sie gehen angstfrei und fordernd mit uns Lehrpersonen um. Es geht nicht darum, pauschal die Volksschullehrer anzuprangern, das Problem liegt bei den pädagogischen Hochschulen. So lernen etwa Lehrerinnen und Lehrer an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH), dass sie den Kindern das phonetische Schreiben beibringen sollen, statt sie mit korrekter Rechtschreibung abzuschrecken. Das hat zur Folge, dass ich viele Lernende in den Klassen habe, die nie aufgehört haben mit dem Phonetisch-Schreiben, weil sich das Schriftbild falsch im Kopf festgesetzt hat. Da die Jugendlichen in der Freizeit nicht mehr lesen, legen sich wenige korrekte Schriftbilder über die falschen, und sie bleiben dabei. Was für ein Irrweg!
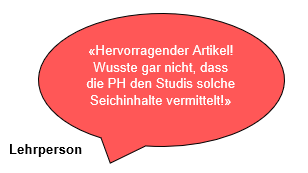
Ein anderes Beispiel: Die Leseforschung zeigt klar, dass lautes Lesen bzw. das Vorlesen enorm wirksam ist beim Erlernen und Verbessern einer Sprache. Aber wehe, eine Lehrerin wie ich wendet diese Methode im Unterricht an und teilt die Erfahrungen damit an der PHZH mit. Nicht nur ich wurde deswegen regelrecht zusammengestaucht von der Dozentin. Schüler vorlesen zu lassen, stelle diese bloss, das dürfe deswegen im Unterricht keinesfalls gemacht werden. Ich erachte es als meine wohl wichtigste Aufgabe als Lehrerin, einen anregenden und sicheren Lernraum zu schaffen. Das heisst, ich bin zusammen mit der Klasse dafür zuständig, dass sich alle getrauen, Fragen zu stellen und Fehler zu machen.
Denn nur aus Erfahrungen lernt man. Das Ausprobieren und das Nicht-auf-Anhieb-Können gehört zum Lernen. Gelingt Vorlesen nicht beim ersten Mal, dann wird es neue Versuche mit Erfolgserlebnissen geben. Von Blossstellen kann keine Rede sein.
Ein anderes Tabu ist das Diktat. Es gilt gemäss PHZH als altmodisch und quälerisch, Diktate zu machen, obwohl es sich dabei um eine wirksame Methode handelt, sich Sprachbilder einzuprägen. Jene Mütter und Väter, die zu Hause mit ihren Kindern Diktate üben, erzielen hervorragende Resultate. Mit Blick auf die Chancengleichheit darf es aber nicht sein, dass Eltern die Aufgaben der Volksschule übernehmen müssen, damit ihre Kinder Basiskompetenzen erlernen. Zur Schule gehören auch Aufgaben, die nicht beliebt sind. Sie deswegen wegzulassen, ist ein Fehler.
Junge PHZH-Absolventen sagen mir, sie legten keinen Wert auf Rechtschreibung, weil Rechtschreibung die Kreativität behindere. Schülerinnen und Schüler aber können problemlos unterscheiden, ob es in einer Aufgabe primär um den Flow des Schreibens und Denkens geht oder um korrekte Verständlichkeit, das weiss ich aus Erfahrung. Es ist zu hoffen, dass die OECD-Studie ein Weckruf für die Ausbildungsverantwortlichen der pädagogischen Hochschulen ist – und ein Appell an alle Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule, den Fokus verstärkt wieder auf die Grundkompetenzen Lesen und Schreiben zu legen.
Maja Peter
Schriftstellerin und Berufsschulleiterin
Quelle: Website Maja Peter, abgedruckt mit Erlaubnis der Autorin