03.01.2025
Bedenkliche Folgen ungebremster Macht
Seit einem halben Jahr unterstehen die Schulleiter/-innen der Sekundar- und der weiterführenden Schulen im Baselbiet faktisch keinen übergeordneten Kontroll- und Aufsichtsbehörden mehr. Seit diesem Systemwechsel, welcher die früher in Anstellungs-, Disziplinar- und Kündigungsverfahren zuständigen Schulräte entmachtet hat, können Schulleiter/-innen weitgehend schalten und walten, wie es ihnen gerade beliebt. Die Folgen sind fatal.
Die Starke Schule beider Basel (SSbB) sieht Anzeichen, die auf eine besorgniserregende Zunahme von Schulleiterwillkür hindeuten. Deutlich mehr Lehrpersonen, die an einer basellandschaftlichen Schule unterrichten, melden sich bei der SSbB und suchen Rat. In mehreren Fällen wurden offenbar Verwarnungen ausgesprochen, die auf fragwürdigen Grundlagen beruhen und persönlich motiviert scheinen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Fälle von Machtmissbrauch bei Schulleiter/-innen zugenommen haben, mit teilweise verheerenden Folgen für die betroffenen Lehrpersonen.
Machtmissbrauch als Folge entsprechender Möglichkeiten
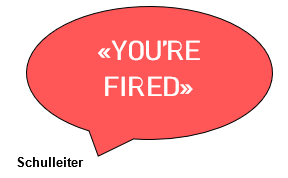
Wenn man feststellen muss, dass es seit dem Stichdatum 1. August 2024 offenbar signifikant mehr solche Fälle gibt als in der Zeit davor, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass dies mit dem Systemwechsel zu tun hat. Es sind zwar dieselben Schulleiter/-innen, die an den Schalthebeln sitzen und Massnahmen verfügen, aber die Strukturen und gesetzlichen Grundlagen, unter denen sie nun agieren, haben sich entscheidend verändert.
Fragt man Juristinnen und Rechtsethiker, warum Missbrauch von Macht überhaupt vorkommt, bekommt man bisweilen die lapidare Antwort: «…, weil es möglich ist». Man könnte noch präzisieren: «…, weil es so einfach möglich ist». Hegte früher ein Schulleiter oder eine Schulleiterin einen persönlichen Groll gegen eine an der Schule unterrichtende Lehrperson, überlegte er oder sie es sich zweimal, ob ein Antrag an den Schulrat zur Verhängung einer disziplinierenden Massnahme gegen diese «zielführend» sein würde; immerhin musste ein solcher Schritt auch überzeugend begründet werden. Fällt die Begründungspflicht weitgehend weg bzw. gibt es keine Instanz mehr, welche die Begründung für eine Verwarnung kritisch prüft, ist die Hemmschwelle sehr viel niedriger.
Es braucht eine unabhängige Schiedsstelle
Man darf nicht ausser Acht lassen, dass der Flurschaden machtmissbräuchlichen Gebarens beträchtlich sein kann. Wenn langjährige, bewährte und berufserfahrene Pädagoginnen und Pädagogen durch willkürliches Agieren einzelner Schulleiter-/innen entmutigt werden, sich für Monate krankschreiben lassen und am Ende gar den Lehrerberuf aufgeben, ist das nicht nur für die betroffenen Individuen äusserst bedauerlich, sondern auch volkswirtschaftlich nicht gerade vorteilhaft. In Zeiten zunehmenden Lehrpersonenmangels wäre zu fragen, ob man mit den Pädagoginnen und Pädagogen als wertvoller Humanressource nicht sorgsamer umgehen möchte.
Einmal mehr steht die berechtigte Forderung nach unabhängigen und kompetenten Schiedsstellen im Raum, welche bei Konflikten zwischen Schulleitungen und Lehrpersonen vermitteln und welche in besonders kritischen Situationen auch Schiedssprüche fällen können, die von beiden (!) Konfliktparteien respektiert werden. Dadurch wäre gewährleistet, dass ein gewisses Gegengewicht zum ansonsten erheblichen Machtgefälle zwischen Schulleiter/-innen und Lehrpersonen vorhanden wäre – ein Gegengewicht, das im Krisenfall verhindern würde, dass letztere ihren direkten Vorgesetzten am Arbeitsplatz schutzlos ausgeliefert sind.
Begrenzte Möglichkeiten der Ombudsstelle
Zwar können Lehrpersonen, die als Folge des Machtgefälles in ihren Schulen unter die Räder kommen, sich an die kantonale Ombudsstelle wenden und dort um Intervention und Mediation bitten, aber Schulleitungen müssen sich de facto nicht an deren Empfehlungen halten. Das Problem der Möglichkeit zum Machtmissbrauch durch Schulleitungen, das durch die früheren Schulräte als übergeordnete Instanzen abgefedert wurde, bleibt unter den neuen gesetzlichen Bestimmungen virulent.
Jürg Wiedemann
Vorstand Starke Schule beider Basel